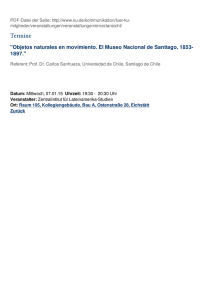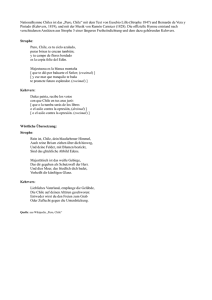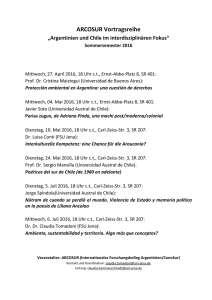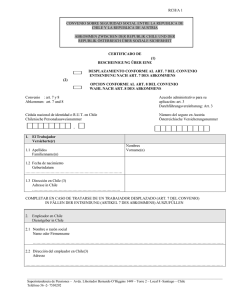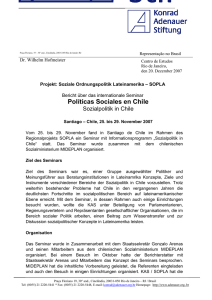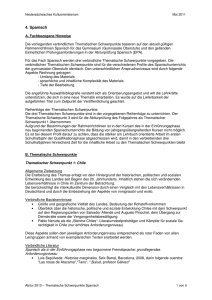WACH ÀVF
V/ACH AUF J'IJT H o H t ZCIT
CHMST
VMCCtTvMC
...
U
L Ä / n AM
¿«IT M Ä Ü f l g p
ÍRajkt
MIT 6£,W€ H , l f
*
Auf dem Wege
Festschrift
PROPST
für
FRIEDRICH
KARLE
in S a n t i a g o / C h i l e
anlaesslich
seines
am
60.
28.
Geburtstages
April
1961
S a n t i a g o
19 6 1
Talleres Gráficos Claus yon Píate — Dublé Almeyda 1368 — Santiago (Chile)
D. ADOLF WISCHMANN — Frankfurt/Main schreibt:
Verehrter, lieber Bruder Karle!
Nun steht die Feier Ihres 60. Geburtstages vor uns.
Als Präsident des Aussenamtes der Evangelischen Kirche in Deutschland
möchte ich Ihnen zunächst im Namen des von mir geleiteten Amtes und zugleich
auch im Namen der Evangelischen Kirche in Deutschland die herzlichsten Wünsche und Grüsse aussprechen. Sie schauen ja auf eine lange und segensreiche
Tätigkeit in der' lutherischen Kirche in Chile zurück. Ich bin mit Ihnen einmal
durch einen Teil des Ihnen anvertrauten Gebietes gereist und habe beobachtet,
wie Sie mit allen Teilen der deutschstämmigen Bevölkerung und auch darüber
hinaus mit weiten Kreisen der chilenischen Bevölkerung befreundet und bekannt
sind, überall begrüssten Sie Menschen, die Sie einmal getraut oder getauft haben
und in deren Häusern Sie mancherlei Amtshandlungen vollzogen. Mit gütiger
und doch weiser Hand leiten Sie die Kirche, die in den letzten Jahren aus verschiedenen Gründen im Bliokfeld der Weltchristenheit gestanden hat. Einmal ist
Ihre Kirche ja neben anderen Diasporakirchen ein Modellfall f ü r die Selbstän-digwerdung der Auslandsgemeinden und Kirchengemeinschaften.
Unter Ihnen
ist die evangelisch-lutherische Kirche in Chile in die weltweite ökumenische Gemeinschaft hineingewachsen.
Darüber hinaus haben die schweren Erd- und Seebeben des Jahres 1960 weite
Kreise der Christenheit aller Konfessionen in Chile, ja auf das chilenische Volk
selber und nicht zuletzt auch auf die mit uns verbundenen chilenischen Christen
aufmerksam gemacht. Eine grosse Welle der Not brach bei Ihnen aus. Eine grosse Welle der Hilfe strömte aus vielen Ländern der Welt zu Ihnen hin. Sie waren
es, der mit den vielen Erfahrungen, Kenntnissen und Beziehungen sehr viele
dieser Nöte und Hilfsmassnahmen auf Herz und Gewissen zu nehmen hatte.
Haben Sie, .verehrter und lieber Bruder Karle, f ü r Ihren weitreichenden, langJährigen, umfassenden und treuen Dienst von 'ganzem Herzen Dank.
Gott möge alles das, was Sie taten, segnen. Er möge Ihnen auch in kommenden Jahren zum Segen unserer Kirche und besonders auch Ihrer evangelisch-lutherischen Kirche in Chile beistehen.
5
Auf alten und neuen Wegen"
Vielleicht ist es gut, dem persönlichen Gruss zum 60. Geburtstag einen Zusatz hinzuzufügen. Inzwischen ist schweres Leid über die Familie Karle gekommen. Sehr schweres Leid. Ich erinnere mich genau, mit welcher Liebs und Hingabe der inzwischen im Dienst der Liebe verunglückte Sohn uns im F r ü h j a h r 1959
Farbbilder vorführte und sie auch durch seine lebendigen Erklärungen erläuterte. Er wollte uns in das Wesen seiner chilenischen Heimat einführen, unsere Augen f ü r ihre Eigenarten öffnen, unsere Herzen f ü r sie erwärmen. E s gelang ihm
in überzeugender Weise.
Man kann diesen Vorgang geistes- und kirchengeschichtlich erweitern. Die
deutschstämmigen Chilenen lieben ihre neue Heimat. Sie stehen zu ihr und leben
in ihr. Die Gruppe der Jungen Gemeinde, die uns 1960 bald nach dem schweren
Erd- und Seebeben in Deutschland besuchte, hat das überzeugend deutlich gemacht.
Aus der Deutschen Evangelischen Kirche in Chile ist die Evangelisch-Lutherische Kirche in Chile geworden. Das deutet nicht nur einen äusseren Namenswechsel an. Die Lutherischen Christen meist europäischer, ja in grosser Zahl
deutscher Herkunft, bejahen damit ihre Existenz als eine Existenz lutherischer
Christen auf chilenischem Boden. Sie haben sozusagen den Absprung von der Heimat und auch der Heimatkirche dokumentiert.
Man könnte eine solche Entscheidung von Deutschland aus gesehen missverstehen. Etwa als Untreue, Vengesslichkeit oder Verleugnung der Herkunft, ja
als Vertragsbruch. Wir wissen, dass es so nicht gemeint ist. Wir nehmen diese
Entwicklung nicht nur zur Kenntnis. Wir begrüssen sie sogar. Wir wissen, dass
damit die Gefahr einer abgekapselten kirchlichen und nationalen Existenz gebannt ist: nämlich die Meinung,' als sei die Vergangenheit zugleich einziges Motiv der Zukunft, der ehemalige Weg zugleich der zukünftige Weg! Wir freuen
uns über die damit dokumentierte Weite, die neue Ufer andeutet, ohne die alten
Gestade zu verleugnen.
Das allerdings scheint u n s wichtig zu sein, dass unsere lutherischen Brüder
und Schwestern in Chile das hohe Gut der Reformation, so wie es sich in Deutschland den Vätern bot, pflegen, neu erkennen, bejahen und ihrer neuen Umwelt
einverleiben.
Wir sagen nicht „Nein" zur Zweisprachigkeit und wissen, dass wir die Lutherische Botschaft jedem in der Sprache schulden, in der er lebt, die er versteht. Wir freuen uns aber nach wie vor über Pflege und Gebrauch der deutschen
Sprache. Sie ist ein Werkzeug der lutherischen Reformation in Deutschland und
6
weit darüber hinaus gewesen. Sie w u r d e ihres Sinnes entleert, ihrer Wurzeln ber a u b t , ihrer T r a g f ä h i g k e i t enthoben. Aber nach wie vor ist sie f ü r den von der
lutherischen Reformation h e r k o m m e n d e n Christen Gefäss und -Form der evangelischen Botschaft in besonders deutlicher, herausgehobener Weise.
Übersetzung des Evangeliums in eine neue Lebens- und Sprachwelt und Weitergabe der Botschaft in der alten Sprache sowie Kennenlernen der Lebenswelt
der Väter und der Brüder in der Heimat stehen als doppelte Aufgabe da. Hinzu
K o m m e n Traditionen evangelisch-lutherischen Glaubens a u s ganz Europa,
aus
ganz Süd- und Mittelamerika, nicht zuletzt auch aus Nordamerika. Nicht unbea c h t e t bleiben darf das lebendige E r b e der Reformation unter Calvin und Zwingli. Hinzu tritt die gliedhafte, lebendige Verbindung mit den uns im Ökumenischen
Rat der Kirchen verbundenen Kirchen,gemeinschaften.
So sind die Aufgaben unserer Zeit nicht kleiner geworden. Im Gegenteil! Sie
sind auch auf diesem Gebiet n u r in Arbeitsteilung zu bewältigen. Sie weiten den
Blick, erweitern den Horizont und machen aus den Gaben der Kirchen grosse
Aufgaben.
Hat die Pflege deutscher K u l t u r in diesem Z u s a m m e n h a n g noch Ziel und
Sinn? Wir meinen, JA!
Alles Leben entsteht aus Begegnung. Wo Kulturwelten einander begegnen,
entsteht reiches neues Leben. Einer gibt dem andern. Einer e m p f ä n g t vom andern. Vielleicht sind unsere Lutherischen Brüder in Chile uns ihren Beitrag zu
uns h e r ü b e r noch schuldig geblieben.
Wer gibt und einbringt, m u s s wissen, w o r u m es sich handelt. So werden deutsche Dichtung, deutsche Lieder und iMusik und vieles andere mit gutem Gewissen
drüben weitergepflegt w e r d e n dürfen. Ja, es m ü s s t e so sein! Niur der gibt und
trägt weiter, der hat, der nachgestaltet, neugestaltet und sich als Glied in einer
langen K e t t e sieht. Wohin es f ü h r t , was daraus wird, steht bei Gott.
Christen dürfen experimentieren. Mit besserem Gewissen als andere.
Sie
wissen um Bindung und Freiheit unter Gott. Bindung allein ist Angst vor dem
Leben. Freiheit allein ist Verrat am Leben. Bindung und Freiheit zusammen sind
stets neu von uns gefordertes Wagnis unter Gott.
7
Dr. WILHELM STADTLÄNDER
Propst Friedrich Karle und die Deutsche Schule
Die Überschrift wirkt im ersten Augenblick etwas befremdend. Was hat die
Kirche unmittelbar mit der Schule oder umgekehrt zu t u n ? Wenn man sich den
Stundenplan der Deutschen Schule ansieht, so entdeckt man, dass der Pfarrer
der Kirchengemeinde dn der Woche drei Religionsstunden erteilt, und zwar eine
im erfeten, eine im zweiten und eine im dritten Humanitätsjahr. Wenn man diese
drei Stunden mit der Fülle der anderen vergleicht, miisste man zu dem Schluss
kommen, dass die Verbindung und der Eimfluss des P f a r r e r s auf die Schule vor
allen Dinger in pädagogischer Hinsicht nur sehr gering sein kann. Das ist aber
nicht so. Der Einfluss von Propst Karle auf das Sehulleben ist ausserordentlich
gross, und zwar von zwei Seiten her betrachtet.
Pfarrer Karle is1 nicht nur ein guter Prediger und ein guter Seelsorger, Sonden auch ein besonders guter Pädagoge. Und diese seine pädagogischen Fähigkeiten sind es, die auch die wenigen Stunden, die er in der Schule gibt, zu einer
grossen Wirkung gelangen lassen. In den Klassen, in denen Pfarrer Karle unterrichtet, herrscht immer eine grosse Fröhlichkeit. Der Grundzug seines Wesens
und damit seines Erfolges ist eine von innen strahlende Heiterkeit. Diese innerliche Gelöstheit, die sich oft in einem befreienden und ansteckenden Lachen äussert, räumt auftauchende Schwierigkeiten und Spannungen schnell hinweg und
schafft immer wieder eine harmonische Stimmung, aus der heraus der Samen
des guten Wortes wächst. Dazu gehört eine ebenso starke Güte, die versteht und
verzeiht, ohne in Schwäche und Nachgiebigkeit auszuarten, weil sie eben keine
Gutmütigkeit, sondern wirkliche Güte ist, die im Ernstfall sich auch durchaus
in Strenge zeigen kann. Propst Karle hat neben diesen beiden beneidenswerten
Eigenschaften von Fröhlichkeit und Güte eine grosse Portion schwäbischen Humors, die mit beiden eng gekoppelt ist, denn der Humor fliesst ja immer aus der
Güte des Herzens. Dieser Humor lässt ihn alles im richtigen Lachte sehen; er
rückt alles wieder zurecht und bewahrt vor Überspannungen. Dazu kommt noch,
dass Propst Karle über ein ausserordentlich starkes Einfühlungsvermögen verfügt, das ihm ermöglicht, auch in die Seelen schwieriger Schüler verständnisvoll
einzudringen. Diese Fähigkeit ward bei ihm sowohl aus der Güte seines Herzens
wie aus der Klarheit seines Verstandes gespeist. Seine Schüler fühlen sich bei
ihm immer verstanden, immer angesprochen und er ist dadurch in der Lage zu
helfen. Dass sein Unterricht nie langweilig ist, liegt an seiner Fähigkeit, ein Unterrichtsgespräch zu führen, das f ü r die klugen Schüler, die etwas wissen und
S
weitergeführt werden wollen., immqr anregend ist und den Schüchternen
die
Hemmungen nimmt, sodass auch sie etwas zu sagen wagen. Und ein letztes: J e mand, der mit jungen Menschen umgeht, darf nie negativ, nie pessimistisch sein,
und Pfarrer Karle ist in einem beglückenden Masse ein positiver Mensch. Immer
und überall weiss er aus den Menschen und aus den Situationen das Beste herauszuholen. Selbst wenn scheinbar nichts Positives da ist, erreicht er, dass das
verborgene Positive irgendwie wächst und sichtbar wird. E r strahlt soviel Vertrauen und Glauben an das Gute aus, dass dem andern nichts übrig bleibt als
auch zu glauben und zu vertrauen. — Eine wirkliche Persönlichkeit in einer
Schule, auch wenn sie n u r drei Unterrichtsstunden in der Woche gibt, strahlt eine
Stärke aus, die in gar keinem Verhältnis zu der gegebenen Stundenzahl steht.
Neben dieser pädagogischen Tätigkeit und pädagogischen Wirkung unseres
Pfarrers an der Schule läuft noch etwas anderes nebenher, das in seiner Wirkung
gar nicht abzuschätzen ist, das aber nur den Eingeweihten ganz klar ist. P f a r r e r
Karle war in den Jahrzehnten seines Hierseins so etwas wie der Getreue Eckart
der Schule. Immer stand er mit Rat und Tat der Schulleitung zur Verfügung. In
den Kriegs- und Nachkriegsjahren war es ausserordentlich schwer, unsere Schule
durch die Fährnisse der Zeit zu lenken. Aiber niemals f r a g t e m a n Propst Karle
vergebens um Rat, immer wusste er eine Antwort, und wenn es nötig war, hatte
er auch den Mut, entschieden Stellung zu nehmen in der von ihm als richtig erkannten Sache.
Die Deutsche Schule verdankt dem ausgleichenden und gütigen Wesen P f a r rer Karies mehr, als diese Zeilen zum Ausdruck bringen können. Die Deutsche
Schule dankt ihm von Herzen f ü r die getreue Hilfe und wünscht ihm und sich
noch viele Jahre gemeinsamer Arbeit,
9
D. Dr. MARTIN HAUG — STUTTGART
Das Geheimnis der Bergpredigt
Eine Meditation über Matth. 5, 1—16.
Die Bergpredigt Jesu hat wieder angefangen zu uns zu reden, um nicht zu sagen, unter uns zu rumoren. Dies zeigt ein Blick in die theologische und kirchliche
Bewegung der Nachkriegszeit in Deutschland und Europa sehr deutlich. Wenn
ein politischer Schriftsteller der Gegenwart vor kurzem geschrieben hat, die Welt
lebe heute an einem Vulkan, dann könnten wir sagen, die Kirche lebe immer an
einem Vulkan, am Vulkan der Bergpredigt. Eben dieser scheinbar erloschene Vulkan raucht wieder vor unseren Augen, der scheinbar feste Boden unsres landläufigen Christentums bebt wieder unter unseren Füssen; ein neuer Ausbruch dieses
Vulkans kündigt sich an. Viel Unruhe in Theologie und Kirche mag daher kommen.
Aber w i e sollen wir die Bergpredigt verstehen? Um ihre Auslegung ist wieder einmal ein weit über das theologische „Fach" hinausreichender Streit in Kirche und P f a r r e r s c h a f t entbrannt.
Zu dieser F r a g e wird im Voraus dreierlei zu sagen sein:
1) Wir sollten die Bergpredigt gar nicht so rasch verstehen wollen, vielmehr
von vornherein damit rechnen, dass sie sich in unser Denk- und Lebenssystem, ob
dies nun ein Idealismus oder ein Skeptizismus, ein Pazifismus oder ein Antipazifismus ist, garnicht einordnen lässt. Die Wirkung auf die ersten Hörer der Bergpredigt war nach Matth. 7, 28, dass die Leute sich über diese Lehre Jesu „entsetzten", dass sie aus all ihren Standpunkten und Systemen gleichsam herausgeworfen wurden, dass sie total umstellen und umdenken (metanoein) mussten. In der
Tat kann es nur so zu einem rechten Verstehen dieses total neuen Wortes kommen.
2) Wir sollten uns an der Bergpredigt auch nicht zu rasch „erbauen" wollen;
es könnte sein, dass sie uns gar nicht aufbauen, vielmehr uns, unser Leben und
unsere Welt, auch unser Christen- und Kirchentum abbauen will, um radikal und
total neu zu bauen.
3) Wir sollten Luthers gute Regel f ü r die Auslegung der Heiligen Schrift:
„Sacra scriptura sui ipsius interpres" sorgfältig beachten und auch die Bergpredigt Jesu nach Matth. 5—7 aus ihrem Zusammenhang mit dem Kontext, mit dem
ganzen Evangelium des Matthäus, insbesondere mit Matth. 3 und 4, und schliesslich mit dem ganzen Neuen und Alten Testament verstehen. „Es geht etwas voraus", sagt der Göttinger Neutestamentier Joachim Jeremias in einer sehr sorgfältigen Auslegung der Bergpredigt; wir werden dabei besonders an Matth. 4, 17
10
zu denken haben. Der Ethik der Bergpredigt geht die Verkündigung der frohen
Botschaft vom Kommen des Reiches Gottes voraus.
Daraus ergeben sich einige G e s i c h t s p u n k t e , die uns f ü r eine sachgemässe und wahrhaft geistliche Auslegung der Bergpredigt wesentlich erscheinen
und die hier in der gebotenen Kürze wenigstens skizziert werden sollen:
1) Wir dürfen ja nicht übersehen, w e r hier redet. „ D a s G e h e i m n i s d e r
B e r g p r e d i g t
i s t d e r B e r g p r e d i g e ¡r"„ sagtl der Basler Theologe und Münsterprediger Eduard Thurneysen fein. Worüber waren denn die ersten Hörer der Bergpredigt nach Matth. 7, 28 ff. so entsetzt? Über den Bergprediger selbst noch mehr als über seine ,,Predigt"! „Denn er lehrte sie .wie einer der
Vollmacht hat" (Matth. 7, 28). Hier war mehr als ein Schriftgelehrter, der das von
Gott gegebene Gesetz auslegt, auch mehr als ein Prophet, der Gottes Verheissungen und Gerichtsdrohungen verkündigt; hier ist der, der Vollmacht hat, Gottes
Gesetz zu erfüllen, Gottes Verheissung und Gericht zu vollziehen. Der Bergprediger selbst ist auch ein ganz wesentlicher Inhalt der Bergpredigt: das Wörtlein
„ich" ist immer wieder stark betont und gleichsam gross geschrieben (5, 22, 28*
29, 34, 39, 44). Ohne Jesus und das Geheimnis seiner Person und Sendung ist das
Wort der Bergpredigt wirklich Un-sinn; durch ihn bekommt es seinen göttlichen
Sinn und seine göttliche Kraft. Die Gebote wie die Seligpreisungen der Bergpredigt
werden nur dann recht gehört, wenn der Ruf Jesu in s e i n e Nachfolge vor ihnen
und gleichzeitig mit ihnen gehört wird. Wenn man schon gesagt hat, die Bergpredigt stelle uns vor eine 1000 Meter hohe, senkrecht aufsteigende Felswand, die
kein Mensch erklettern könne, so ist dies durchaus richtig; nur muss man dazu sagen, dass der Bergprediger selbst oben steht, nicht unten und die Seinen zu sich
auf die Höhe geholt hat, so dass sie nun gerade nicht mehr auf die Höhe klettern,
sondern bei ihm, mit ihm auf der sonst unerreichbaren Höhe bleiben sollen und
dies auf ihrem Wege durch die Welt.
2) Wir dürfen ja nicht übersehen, w e n die Bergpredigt anredet, w e m sie gilt.
Der Evangelist, der in Matth. 5—7 ihm überlieferte Einzelworte Jesu zu einer ersten Rede Jesu von der neuen Gerechtigkeit geistvoll komponiert hat, hat in der
kurzen Eingangsnotiz ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die folgenden Worte
Jesu nicht als eine Volksrede an jedermann, sondern als eine Jüngerlehre verstanden. werden soll. (5, 1 ff.). Die Bergpredigt ergeht nicht an den Herrn Omnes, wie
Martin Luther gerne gesagt hat, auch nicht an eine Elite, die wir selbst herstellen
könnten, sondern an die Elite Jesu, an die, die er in seine Gemeinschaft und Nachfolge r u f t und die sich von ihm rufen lassen. „Ich aber sage e u c h " (5, 22, 28, 29,
39, 44). „ I h r seid das Salz der Erde." „ I h r seid das Licht der Welt" (5, 13, 14).
Die von Jesus unermesslich reich Beschenkten werden hier auch grenzenlos verpflichtet und nur sie. D i e B e r g p r e d i g t
istkeine
Allerweltrede, s o n d e r n J ü n g e r l e h r e , Anrede an die Mannschaft Jesu, Aufruf
an die Stadt auf dem Berge, die nicht wir Menschen bauen, Reichsordnung f ü r
die erwählten berufenen Bürger dieses Reiches ohnegleichen. Wenn man von einem Ethos der Bergpredigt reden will, muss man von einem Ethos der Gnade
reden.
3) Wir dürfen gerade dabei nicht übersehen, dass die Bergpredigt bei dieser
speziellen Adresse, bei dieser partikularen Anrede an eine Auswahl einen u n i v e r 11
s a l e n H o r i z o n t hat, dass sie die Erde und die Welt ins Auge fasst. „Ihr seid
das Salz der E r d e". „Ihr seid das L i c h t der W e 11" (5, 13, 14)). Mit diesen Sätzen
protestiert die Bergpredigt selbst unüberhörbar gegen jedes n u r individualistische,
nur esoterische und sektenhaft-separatistische Verständnis, als ob es hier um die
F o r m u n g eines f r o m m e n Ordens abgesehen von der Kirche und der Welt ginge.
E s geht hier u m die riesengrosse Verantwortung u n d den weltweiten Dienst des
kleinen Häufleins der J ü n g e r Jesu und u m nicht weniger als dies.
Und es geht hier wirklich u m d i e E r d e u n d d i e W e l t , u m die m e n s c h l i c h e Gesellschaft. Die kirchliche Auslegung h a t die Bergpredigt oft genug missverstanden und missdeutet, wenn sie das Ziel des Bergpredigers von der Erde weg
in den Himmel verlegt hat. Demgegenüber h a t schon der ältere Blumhardt mit
Recht geäagt: „Das Ziel J e s u liegt durchaus auf der Erde, in der Welt." Der geistvolle katholische Denker R o m a n o Guardini hat das gute Wort geprägt: „Die Bergpredigt ist die E r s c h ü t t e r u n g der Welt vom Himmel her". Aber eben diese E r s c h ü t t e r u n g und E r n e u e r u n g der Erde, der menschlichen Gesellschaft, der Welt vollzieht der Bergprediger n u n nicht direkt durch irgend ein W e l t r e f o r m p r o g r a m m
oder irgend eine Weltrevolution, sondern indirekt auf dem Umweg über die kleinen
Häuflein J e s u in der Welt, über eine von ihm engriffene und e r n e u e r t e „schöpferische Minderheit", über den unscheinbaren S t o s s t r u p p seiner J ü n g e r . Insofern
gleicht jedes W o r t der Bergpredigt, wenn es n u r ü b e r h a u p t a n einer Stelle der
Weit einschlägt, einem Steinwurf, dessen Wellenschlag bis an die ä u s s e r s t e n Ufer
der Welt reicht, einer umwälzenden Bewegung, die durch alle Reiche und Bereiche
dieser Welt hindurch geht.
4) Wir d ü r f e n auch nicht übersehen, dass d e r „nova lex" der Bergpredigt
Matth. 5, 1 7 f f . d a s E v a n g e l i u m
d e r M a k a r i s m e n vorausgeht. Die
Bergpredigt beginnt mit dem „Lied von der F r e u d e " ; schon deshalb kann ihr Sinn
nicht darin liegen, ein unerfüllbares Gesetz zu verkündigen und ihre Hörer durch
die Erkenntnis ihrer S ü n d h a f t i g k e i t in die Verzweiflung hineinzutreiben, aus der
heraus sie dann nach der Gnade Christi r u f e n sollen. An ihrem A n f a n g steht das
Heil, das in J e s u s in eine Welt voll geistlicher A r m u t und Todesleid, voll Gewalth e r r s c h a f t und Ungerechtigkeit einbricht, das auch denen bleibt und zuteil werden
wird, die in J e s u Nachfolge in, schwerem Dienst und Leiden stehen, und darum
auch der achtfache Heilruf mit der Verheissung der heilvollen Z u k u n f t . E s fehlt
hier der Raum, die 8 SelLgpreisungen i m Einzelnen auszulegen; im Z u s a m m e n hang unseres T h e m a s ist n u r wichtig, dass wir diesen evangeliumsgeladenen Eingang beim Weiterlesen der Bergpredigt nicht vergessen. Die ganze Nachfolge der
J ü n g e r Jesu, so viel es in ihr auch Schweres zu t u n und zu leiden gibt, s t e h t im
Licht des F r e u d e n m e i s t e r s und seiner Seligpreisungen.
5) Endlich werden wir auch d i e Z e i t f o r m d e r S e i i g p r e i s u Ilg e n genau beachten müssen, w e n n wir den Sinn der Bergpredigt recht erfassen
wollen. Die rechten Hörer der Bergpredigt werden nicht einmal in der Z u k u n f t
selig sein, die nach der Gerechtigkeit H u n g e r n d e n und D ü r s t e n d e n werden nicht
erst in der Z u k u n f t g e s ä t t i g t werden; das I m p e r f e k t u m der Verheissungen Jesu
in der a r a m ä i s c h e n U r s p r a c h e m u s s und darf als f u t u r u m p r a e s e n s verstanden werden. Die Z u k u n f t , die hier verheissen wird, h a t schon begonnen; denn
der Heilsbringer und der E r f ü l l e r des Gesetzes ist schon da. Die Hörer dieser Rede
12
Jesu sind nach einem schönen Bild von Karl Heim in der Lage der Kriegsgefangenen in den Lagern, die den Entlassungsschein schon in den Händen haben, die darum schon in, der grossen Freude stehen, aber noch nicht zu Hause, sondern nun
auf dem frohen Weg nach Hause sind. Insofern kann man die Gebote der Bergpredigt als Interimsethik verstehen; man muss aber, dieses Interim dann auch in
dem hellen Schein der Gnadenzeit zwischen Jesu erstem und letztem Kommen sehen und darf auch die Worte von 5, 13—16 als eine Seligpreisung lesen und nicht,
jedenfalls nicht n u r als ein hartes Gebot. Die Jünger Jesu sollen ja nur sein und
werden, was sie durch den gnädigen Ruf Jesu sind.
Wir werden gerade heute mit der rechten Auslegung sowohl der einzelnen
Worte wie der ganzen Komposition der Bergpredigt nach Matth. 5—7 aufs neue
viel zu tun haben; der literarkritischen, exegetischen, dogmatischen und ethischen
Probleme sind „Legion". Aber wir werden von manchem bisherigen Missverständnis der Bergpredigt als Ganzes von vornherein bewahrt werden, wenn wir an dem
sogenannten Eingang 5, 3—16 nicht vorübergehen, sondern in ihm das Vorzeichen
sehen lernen, unter dem alles Folgende steht. Dies und nur dies wollte diese Meditation zu bedenken geben, damit wir die Bergpredigt als Evangelium verstehen
und verkündigen lernen.
13
D. THEODOR HECKEL — München
Panis pro vita mundi
Eine lutherische Studie
Entnommen dem Buch des Verfassers: Kirche, Wahrheit, Recht
(München, 1961).
Bischof Heokel geht im folgenden Aufsatz auf die von Luther
durchgeführte Ablehnung des „Fronleichnamsfest" ein, bei dem die
vom Priester geweihten Hostien dem Laien zur Anbetung gezeigt und
in einer Prozession der Welt vorgeführt wurden. Nicht darauf kommt
es an — so sagen Luther und der Verfasser — dass wir im Essen der
geweihten Hostie uns den Opfertod Jesu körperlich oder bildlich zu
eigen machen, sondern dass wir im Glauben an ihn und sein Sterben
Gottes Urteil über uns empfangen, aber auch das neue Leben annehmen, das Gott uns in und nach diesem Urteil gibt. Der Bibeltext Ev.
Johannes Kap. 6 spricht von diesem einzigen geschichtlichen Opfer
Jesu (sein Kommen und Leiden in Fleisch und Blut im Bilde des
himmlischen Brotes), das nicht durch eine priesterliche Formel wiederholt werden kann, sodass wir auch nicht die Hostie, sondern den
Heiland im Glauben anbeten wollen.
Der Aufsatz benutzt teilweise die lateinische Sprache, in der Luther seine Bibel las und seine Kommentare schrieb, sodass er nicht
für alle Leser ganz verständlich ist.
Der 37. Eucharistische Kongress 1960 in Müjichen stand unter der Losung:
Panis pro vita mundi. Auf dieses biblische Wort waren alle Probleme des Kongresses bezogen. Wie und in welchem Ausmass die Eucharistie bis hin zu den
kulturellen Aufgaben in Anspruch genommen wurde, war f ü r uns überraschend,
da wir nach dem Neuen Testament das Abendmahl nicht als Missionssakrament
für die Welt verstehen. Aber davon soll hier nicht die Rede sein, sondern wir wollen die exegetische Frage stellen. Die Losung des Eucharistischen Kongresses
war sachgemäss nach der Ordnung des Fronleichnamsfestes aus dem Joh. Evangelium, 6, 49—57 und zwar aus dem 51. Vers geschöpft: „Und das Brot, das ich
geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde f ü r das Leben der Welt".
Wenn wir die exegetische Frage stellen, so können wir nicht die exegetische
14
Dogmengeschichte über den ganzen Abschnitt aufrollen. Diese ist bekanntlich sehr kontrastreich, auch sehr aufschlussreich.
Sie hat f ü r die gegensätzlichsten Theologumena, auch Häresien dienen müssen: f ü r die „Irrlehre
der Hussiten" (Luther) von der Kinderkommunion, f ü r die Konkomitanzlehre,
für massiven kapernaitischen Sakramentarismus ebenso wie f ü r die spirituelle
augustinische Auslegung. Das können wir in ganzer Breite nicht entfalten. Wir
fragen nach dem exegetischen Verständnis, weil wir selbst bei diesem Schriftabschnitt durch Luthers Schriftauslegung und durch das evang.-luth. Bekenntnis
vor eine Frage und Entscheidung gestellt sind.
In der Solida Declaratio der Konkordienformel wird toei dem Problem der
manducatio carnis „des Essens" eine doppelte manducatio unterschieden:
Die
manducatio spiritualis — die geistliche Messung — und die manducatio corporalis
— das leibliche Essen. In diesem Zusammenhang wird Joh. 6 zitiert. „Hier spricht
Jesus v o r n e h m l i c h von der manducatio spiritualis, welches nicht anders als
mit dem Geist und Glauben in Predigt und Betrachtung des Evangeliums ebensowohl als im Abendmahl geschieht
" (B. K. 993, 61). „Geistliches Essen aber
ist nichts anderes als der Glaube." Das sakramentalische Essen ist ein mündlich
Essen; aber wesentlich ist nicht das mündliche Essen als solches — das wäre kapernaitisch — sondern es geht um die supranaturalis et incomprehensibilis manducatio corporis — „um das übernatürliche und unbegreifliche Essen des Lebens."
In dieser Aussage der „Solida Declaratio" ist die theologische Auslegung Luthers
zu dem genannten Abschnitt aus Joh. 6 in Kürze festgehalten, wobei wir auf die
vorsichtige Klausel „vornehmlich" aufmerksam machen.
Es wird aber zur Klärung dienlich sein, wenn wir Luthers eigene Stellung zu
Joh. 6, 49 ff. näher beleuchten. Wir nehmen dazu zunächst die erhaltenen Predigten vor, die Luther über diesen Text am Fronleichnamsfest gehalten hat. Die lateinische Fassung der Fronleichnamspredigt von 1519 enthält im Kern die Hauptgesichtspunkte, die Luther auch später entwickelt hat. Die manducatio carnis ist
das Entscheidende. „Sola manducaio carnis vivificat." Aber ist die manducatio
carnis, von der dieses Evangelium spricht, mit der manducatio corporis im Sakrament des Abendmahls identisch? Ist hier von der Eucharistie die Rede? Luther
verneint das. „Hoc Evangelium prorsis nihil de sacramento dicit, sed d e f i d e
verbi incarnati, ut manifestum est ex verbis cum superioribus tum sequentibus."
(WA 4, 700/22). Hoc manducare aliud nihil es quam credere Christum sibi caro
factum.
Zur Begründung f ü h r t Luther im wesentlichen d r e i Gesichtspunkte an. Erstens: es kann sich hier nicht um ein äusserliches Nehmen handeln, sondern um
Christus. Warum nicht? E s folgt der überraschende, ausgreifende Gedanke, wenn
'es um das sakramentliche Essen und Trinken ginge, dann wären alle Propheten,
Kinder, Kranke und am Abendmahl Verhinderte verdammt, da Christus ausdrücklich sagt: „Wer mein Fleisch nicht isset, der ist verdammt." Diese Absurdität der
Verdammnis der Propheten etc. beweist, dass nicht vom Sakrament, sondern vom
Glauben an Christus die Rede ist. Luther zieht zum Beleg die Stelle 1. Kor. 10,
3 an. In einer späteren Äusserung füihrt er an, dass die „Böhmen" durch ihre
Interpretation dieser Stelle auf die Eucharistie und in logischer Konsequenzmacherei zu der Irrlehre des Kinderabendmahls gekommen seien (WA, XVII, 2 435).
15
Zu dieser ersten Gedankenreihe tritt eine zweite. Luther nimmt das Johannesevangelium sozusagen ganz in der Zeitfolge der Darstellung, d. h. das Abendmahl war noch nicht eingesetzt.
Der dritte Grund • ist der, wenn Jesus vom Abendmahl spräche, dann würde
er nicht sagen mea caro est cibus, sondern er würde — wie alle Zeugen des Abendmahls das bestätigen — sagen: corpus meum est cibus. Jesus aber spricht nicht
von der Eucharistie, sondern von seiner Menschwerdung, von seinem Leiden, Sterben und Auferstehen, und von dem Teilhaben der Menschen daran, von dem Glauben, de fide. Essen und Trinken sind nichts anderes als Gleichnisreden vom Glauben, der Anteil erhält an dem fuer das Leben der Welt einmal in den Tod gegebenen. roenschgewordenen Sohn Gottes.
In einer in die letzten Tiefen des Verhältnisses von Gott und Mensch hinuntersteigenden biblischen Besinnung über Hungern und Dürsten des Menschen wiTd
gezeigt, dass das Hungern und Dürsten, die absentia gratiae Dei, d. h. die Abwesenheit der Gnade Gottes ist, und umgekehrt, dass Christus die Gnade durch die
assumptio carnis — Annahme des Fleisches — dem Hungernden und Dürstenden
zuwendet, und diese durch das Essen und Trinken, d. h. durch den Glauben an der
Gnade Anteil haben. Wenn hier von dem Sakrament des Altars die Rede wäre,
dann würde folgen, dass auch die selig wären, die auch nur einmal kommuniziert
hätten, auch Judas Ischarioth (WA 4, 703, 33).
Summa: Dieser Abschnitt handelt nicht von der Eucharistie, sondern von dem
Verbum incarnatum und dem Glauben. Alle anderen Auslegungen, die auf das
Sakrament des Altars bezogen sind, f ü h r e n in Engpässe hinein und werden dem
Ganzen der Rede Jesu nicht gerecht. Luther f ü h r t dann ausdrücklich aus, dass
damit nicht die Eucharistie entwertet werde, im Gegenteil; aber die Eucharistie
als das Signum, das Christus dem Glauben angeheftet habe, sei das viaticum et
confortatium itineris in mundo, das aufhört, aber nicht höre in Ewgikeit auf caro
et sanguis Christi.
Die Kritik an dem Pomp des Fronleichnamsfestes und dem liturgischen, unverstandenen Gemurmel, mit den verderblichen Indulgenzen verbunden, ist scharf;
aber noch will er die Ordnung der Kirche und die Prozession nicht zerstören, wenn
der Blick nur auf das eigentliche Gut gerichtet werde, die Anbetung Christi.
Diese Grundposition behält Luther später exegetisch bei. Vom J a h r e 1522 ist
uns noch eine Fronleichnamspredigt Luthers vom 4. J u n i erhalten (WA 12, 578).
Es scheint, dass da in Wittenberg zum letztenmal das Fronleichnamsfest mit Prozession gefeiert wurde. Es ist anzunehmen, dass 1523 das Fest nur durch Predigtgottesdienst begangen wurde. In dieser letzten Predigt Luthers über Joh. 6 wird
der Ton gegen die Auslegung auf die Euchaistie und das Fronleichnamsfest sehr
viel schärfer. Die Verkehrung des wahren Verständnisses dieser Stelle ist ein
Werk des Papstes oder des Teufels. Er meint, Thomas von Aquin sei an der Sache
schuld. „Darum bin ich keinem Fest nie feinder gewest, denn diesem Fest und
unserer Frauen Empfängnis" (WA 12, 581, 31).
Der Gesamtduktus der Exegese Luthers zu Joh. 6 bleibt. Er hat sie noch einmal breit entfaltet in der Auslegung des 6. Kapitels in Wittenberg 1530, 31 und 32.
Aber immerhin war inzwischen noch einiges geschehen, wodurch Luthers Toleranz
eine Änderung erfahren hat, z. B. in der Entscheidung Luthers f ü r beiderlei Ge16
stalt des Abendmahls. Zu diesem Wandel seiner Stellung hat sich Luther in der
Schrift übet die „Babylonische Gefangenschaft der Kirche" ausdrücklich bekannt,
dass er gegenüber seiner früheren Haltung einen Fortschritt gemacht habe. Er
dringt nun unbedingt auf die biblische Austeilung in beiderlei Gestalt. Er wiederholt seine Stellung zu Joh. 6, beruft sich erneut auf das bekannte Augustin-Wort
„crede et manducasti". Aber man liest dann nicht ohne Verwunderung in seinem
Brief an Herzog Albrecht von Preussen 1532 (EA 54, 283), nachdem er Joh. 6 in
dem geistlichen Sinn de fide ausgelegt hat:
doch hiemit wir nicht verdammen die Väter und Lehrer, so Joh. 6 zum Abendmahl gebraucht und gezogen haben, wie sie wohl mehr Sprüche oftmals uneben führen. Denn ihre Meinung ist
doch ja recht und gut, dass sie damit bezeugen, es sei wahrhaftig Fleisch und Blut
Christi im Abendmahl."
Wenn wir das Ganze überschauen, so werden wir dem hermeneutischen
Grundsatz Luthers zustimmen, dass man den Abschnitt des Joh. Evangeliums 6,
49 ff. nicht von dem Ganzen der Speisung der 5000 und der folgenden Rede "in Joh.
6 isolieren darf. Der Skopus des Ganzen ist aber, wie S t r a t h m a n n mit Recht sagt,
die johanneische Darstellung „des Ärgernisses des Kreuzes" in der Auseinandersetzung mit dem enthusiastischen Messianismus der Galiläer. Zweitens wird man
darin Luther folgen müssen, dass das Brot f ü r das Leben der Welt der einmal geopferte Christus ist; und drittens darin, dass es sich bei Essen und Trinken um
den Glauben, d. h. Aneignung und Teilnahme an dem menschgewordenen, gekreuzigten und auferstandenen Christus handelt und nicht um einen unmittelbaren •
Bezug auf die Eucharistie.
Dio Auslegung Luthers, die den Bezug auf die Eucharistie verneint, wird /von
einem grossen Teil der modernen Ausleger bestritten. Wir können drei Lösungen
in.der gegenwärtigen Auslegung unterscheiden. Die eine, die den ganzen Abschnitt
als kirchliche Redaktion ausscheidet; das tut Bultmann. Nach seiner Auffassung
ist „zweifellos" vom Herrenmahl die Rede aber in der Weise der „Unsterblichkeitsmedizin" bzw. „des ewigen Lebens, die befremdend ist im Ganzen des Joh.
Evangeliums". In scharfer Antithese erklärt E. Hirsch in seiner Auslegung des
4. Evangeliums, vom Herrenmahl ist zwar die Rede, aber wer diese als Unsterblichkeitsmedizin versteht, hat von dem Geist des Joh. Evangeliums überhaupt noch
nichts begriffen. Es handle sich vielmehr um die spirituale, über Paulus noch
hinausgehende, alle Abendmahlmystik und jeden Sakramentalismus überwindende
spirituale Deutung des Abendmahls, in dem das Brot als Zeichen des Todesleibes
Christi nicht die Gabe sei, sondern als Zeichen die Vollmacht Christi enthülle,
durch seinen Tod der Lebensspender durch den Geist zu werden. Jede gegenständliche Beziehung wird nach Hirsch durch diese Dialektik und den Akt des
heiligen Geistes ausgeschaltet. Ist. das aber noch das Abendmahl?
Aber auch ein so konservativer Exeget wie Theodor Zahn will bei der Auslegung Luthers nicht bleiben. Er polemisiert gegen die von Augustin beeinflusste
Interpretation Luthers, dass es sich um den Glauben handle. Er will das „Ich
werde geben" nicht als Hingabe in den Tod verstehen, sondern als eine futurische
Aussage, die sich auf die Zukunft der Gemeinde beziehe, welche zwischen der Gegenwart des Erdenlebens Jesu und der Endzeit liegt, in der Jesus in seine himmlische Heimat zurückgekehrt ist (V. 61). Johannes 6 sei eine Weissagung, die im
17
Abendmahl zur Erfüllung kam. Es handelt sich „um die Erhaltung des durch die
Neugeburt dem Menschen eingepflanzten neuen Lebens." Diese bedürfe „der fortgesetzten Einhaltung". Es scheint mir hier in anderer Sprachform die Auffassung
des Ignatius wiederzukehren von dem Pharmakon athanasias und von der Ernährung und Erhaltung des dem wiedergeborenen Menschen eingepflanzten Auferstehungsleibes — eine Auffassung, die auch Burger in seinem Johannes-Kommentar erörtert. Wo ist aber in diesem Abschnitt oder vorher in Joh. 6, von diesem
Theologumenon, „der anderen Lebensbasis" die Rede? Was Zahn aber auch sagt,
ist dies, dass es sich nicht um das Abendmahl direkt handelt, sondern um einen
besonderen ¡Bezug auf das Abendmahl f ü r die künftige gläubige Gottesgemeinde
als dem Viaticum, das im Abendmahl von Christus gespendet wird und die Gemeinde im Glauben erhält. Zahn will die Christengemeinde als Gegenbild zur wandernden Wüstengemeinde in diesem Teil genau festhalten. Während jene mit irdischem Manna gespeist wird und doch stirbt, wird diese mit dem Brot des Lebens
von Christus gespeist und stirbt nicht. Trotz seiner von Luther abweichenden Auslegung bezieht er das Panis pro vita mundi nicht auf die Welt, sondern auf die
gläubige Gemeinde, die durch die Wüste der Welt dem Ende zuwandert.
Man wird sich dem Gewicht der Stimmen nicht entziehen ikönnen, die eine
Beziehung zum Herrenmahl als gegeben ansehen. Aber die Frage ist, welcher Art
sie ist. Handelt es sich um direkte Belehrung, E n t f a l t u n g oder Deutung des Abendmahls? Die Lösung — und darin haben die Ausleger recht, die es mit Luther halten — ist aus dem Ganzen des Kapitels zu entnehmen. F ü r viele, z. B. Schlatter
u. a. nehmen wir' Strathmann. Er sagt in seiner Auslegung des Johannes-Evangeliums im Neuen Testament deutsch: „Jesus stellt der .irdisch-phantastischen Messiaserwartung den gewaltsam getöteten, also den gekreuzigten Menschensohn gegenüber." So hat Johannes das Ärgernis des Kreuzes geschildert. Das ist das eigentliche Ziel des Kapitels. Der Schluss des Kapitels bringt die Entscheidungsfrage an die Hörer, dass der Glaube an den Menschengewordenen und Gekreuzigten
das ewige Leben bringt. Das würde im Blick auf Luthers Exegese heissen: Der
Schwerpunkt liegt auf dem Kreuzestod Christi. Er ist das Brot f ü r das Leben der
Welt, Grund und Voraussetzung f ü r das, was im Abendmahl geschieht.
Aber ich möchte darin der Korrektur der lutherischen Auffassung beipflichten, wenn Strathmann weiter sagt: „Die Ausdrucksweise freilich ist offensichtlich
durch die Erinnerung an das Herrenmahl, seine E i n f ü h r u n g und seinen Brauch
bestimmt und ohne diese Beziehung nicht verständlich; aber daraus folgt nicht,
dass hier eine Belehrung über dieses Mahl erteilt werden soll. Das ist nicht das
Thema. Das Abendmahl liefert nur das Bildmaterial f ü r die Wahrheit, um die es
sich, handelt. Somit sind die Ausführungen weder gedacht noch geeignet, als
Grundlage für die Entwicklung einer Abendmahlslehre zu dienen." (S. 126).
„Das, wovon die Welt lebt, ist das ein f ü r allemal gebrachte Opfer am Kreuz
Jesu Christi. Pro vita mundi deutet auf das Kreuz Christi, nicht auf das Messopfer;
auf Golgatha und nicht auf die gewandelte Hostie. N u r in abgeleiteter Form
spricht dieses Evangelium vom Abendmahl" (A. Schabert).
18
LITERATUR:
Luther WA 4 700; WA 6, 484; WA 12, 578; WA 17 2, 435; WA 33, 167 f f ; Bek.
Schriften der Evang.-Luth. Kirche Sol. Declaratio 993, 61.
Bultmann, Das Evangelium des Johannes — Göttingen 1953.
Burger, Das Evangelium nach J o h a n n e s 1868.
Hirsch, Das 4. Evangelium — Tübingen 1936.
Stiathmann, Das Evangelium nach Johannes im N T deutsch — Göttingen 1955.
Zahn, Evangelium des J o h a n n e s — 1921.
19
BRUNO LEUSCHNER — Santiago
Angst und Hoffnung
Überblickt man einmal, wie zielbewusst die Menschheit und vor allem das
Abendland in der Zeit von der Mitte des 19. bis zu unserer Mitte des 20. Jahrhunderts das materielle Weltbild erweitert, ausgebaut und vertieft hat, so dass die
Fülle des Wissens auf diesem Gebiet gar nicht mehr zu überschauen und das
Grossartige der erreichten faktischen .Leistungen kaum noch zu fassen ist; so ist
es doch eigentlich erstaunlich, wie sehr diese gleiche Menschheit, und wieder vor
allem diese gleiche abendländische Völkergemeinschaft vom Zweifel und vom
Pessimismus gepeinigt wird.
Denken wir doch einmal zurück an jene Zeit der Selbstgewissheit über den
eingeschlagenen Weg, der Zufriedenheit mit sich selbst und des Optimismus. Das
Wahre, Gute und Schöne (Begriffe, die man damals gern benutzte) schien, wenn
nicht schon da, so doch zumindest in Kürze erreichbar, dem Zugriff sicher, unaufhaltsam wachsend und sich entwickelnd.
Dahin ist dieser Optimismus! Das 20. J a h r h u n d e r t musste ganz andere Erfahrungen machen. Der kunstvolle Überbau des Lebens, die Kultur, ist fragwürdig,
zerfällt ins Fragmentarische; das fortschreitende Wissen bringt uns an kein
Ziel; der Mensch ist ein Raubtier, einer des anderen Wolf; die Technik erzeugt
wachsenden Wohlstand, aber mit und in ihr wächst auch die Möglichkeit absoluter
Zerstörung alles Wohlstandes, ja alles Lebens überhaupt.
Statt eines völkeryerbrüdernden Pazifismus, an dessen Kommen man damals
glaubte, hatten wir immer neue und immer schrecklichere Kriege. Wie schien
vor hundert Jahren alles anders! Versetzen wir uns einmal zurück in jene Welt,
die wenn sie auch durchaus nicht immer zivilisiert war, sich doch für zivilisiert
hielt. Wir wissen heute, wie gedankenlos grausam die Europäer jener Epoche
den Unterdrückten, den farbigen Völkern gegenüber sein konnten. Aber das damalige Zivilisationsbewusstsein, also das Wunschbild, das man von der Gesellschaft hatte, verurteilte diese Ausschreitungen. Man schaffte die Sklaverei ab
und die Kinderarbeit, man humanisierte die Gefängnisse, schuf das Rote Kreuz,
regte sich über Tierquälerei auf. Man fand seine Ansichten verkörpert in sentimental humanitären Gedankengängen
a la Onkel Toms Hütte und Oliver Twist
oder in der Gesellschaftskritik von Zola, Ibsen und Gerhart Hauptmann. Niemand aber, oder doch nur ganz wenige prophetische Geister hätten in jener Zeit
fünf bis zehn Jahrzehnte vor der unsrigen, die unfassbaren Greuel voraussehen
können, die im 20. Jahrhundert Über die Welt und vor allem Europa hereinbre20
chen sollten, w a h r h a f t Zeiten wie einst unter Dschingis Khan. Waren je seit dem
Einfall der Mongolen so viele Menschen, so viele ganze Völkerstämme hingemordet, ausgerottet w o r d e n ? Man erinnert sich nicht gerne daran, aber man kann
es auch keine Minute vergessen, das Schicksal der baltischen Nationen, die es g a r
nicht mehr gibt, der Polen unter der deutschen und dann unter der sowjetischen
Besetzung, der Zigeuner, der Krimkosaken, der Wolgadeutschen, der deutschen
Ostvertriebenen, jener 15 Millionen die als Folge der T e i l u n g Indiens die Heimat
verloren. Man denke an die Rolle, die der Mensch als Bestie in diesen Kriegen
und Umstürzen gespielt hat und weiter spielt. Man denke an Hiroshima und Nagasaki. Wer hätte vor hundert J a h r e n je geglaubt, dass Russland, ausgerechnet
das christliche Mütterchen Russland, unter der F a h n e des Materialismus
und
Atheismus zur Bedrohung der christlichen Welt werden w u r d e ? D a s s es ihm
mit Hilfe einer Persiflage der abendländischen Philosophie gelingen würde, bis
zur Mitte des 20. J a h r h u n d e r t s über eine Milliarde Menschen ideologisch zu mobilisieren, gegen das Abendland?
Und wer hätte auch n u r ahnen können, dass E u r o p a diesen Erscheinungen
nichts Rechtes m e h r entgegenzusetzen haben w ü r d e ? Dass es seine schöpferische
Stärke und Leistungsfähigkeit selbst durch Zweifel untergraben, seinen Elan Vital in Angst und Selbstaufgabe verwandeln w ü r d e ?
Nicht, dass diese Angst unbegründet wäre. Jeder k a n n sich j a ausmalen,
welche Folgen ein Atomkrieg f ü r E u r o p a haben würde. Ebenso k a n n sich jeder
vorstellen, was ein Einbruch der revoltierenden f a r b i g e n Völker in E u r o p a alles
mit sich bringen könnte. Und selbst uns in diesem L a n d e sind seit den Ereignissen in Cuba und in Bolivien die Augen d a f ü r aufgegangen, dass eine latente Gef a h r vorhanden ist in den armseligen Menschenmassen, auf deren Kosten der im
Lande existierende Wohlstand aufgebaut ist. Wehe uns, w e n n es einmal losgeht,
ehe alle diese Menschen wirklich in unsere Zivilisation a u f g e n o m m e n und eingebürgert sind. „ A u f n e h m e n " bedeutet dabei nicht, Geschenke und milde Gaben
auszuteilen, sondern bedeutet, diesen Menschen echte Chancen einzuräumen, ihnen brüderlich entgegenzukommen, ihnen dazu zu verhelfen, ihre Fähigkeiten
wirklich i n der Gesellschaft und nicht unter oder a u s s e r h a l b ihrer zu entwickeln.
Sind wir aber zu einer solchen Einstellung und Umstellung bereit? Und wenn du
und ich es sind, ist unsere herrschende Gesellschaft dazu bereit?
• Zu diesem düsteren politischen Bild kommt die philosophische Ratlosigkeit
hinzu. Statt auf die „Fülle" stiess die fortschreitende menschliche V e r n u n f t des
20. J a h r h u n d e r t s auf das „Nichts". Hi'er haben wir die Grundlagen f ü r die „Angst",
die das 20. J a h r h u n d e r t erfüllt. Alles dies k o m m t vom neunzehnten und schon
von f r ü h e r e n J a h r h u n d e r t e n her, sie sind voller Symptome, auch fehlt es nicht
an warnenden Stimmen, wie .die von Tocqueville, Nietzsche, Kierkegaard. Eben
der letzte m u s s hervorgehoben werden, ist doch seine. Abhandlung „Der Begriff
Angst" gleichsam der A u s g a n g s p u n k t f ü r unsere zeitgenössische Philosophie, deren Zentralthema die Angst ist, die Ungewissheit, das „Geworfensein", wie Heidegger gesagt hat. Meinem Gefühl nach ist schon in Kierkegaard alles enthalten.
Er sieht die existentielle Gefahrensituation des Menschen, ohne diesen von seinein religiösen Daseinsgrund zu lösen, d. h. unter der Voraussetzung der Gegenwärtigkeit des Göttlichen. Wenn diese von den Heutigen, von Heidegger, J a s p e r s
21
oder gar Sartre negiert wird, so können sie zwar philosophisch und psychologisch
immer tiefer in das Unglück des Menschen eindringen, nehmen ihrer Deutung
aber die metaphysische Tiefe.
Wollen wir also über die Angst reden, über die lähmende, im Pessimismus
wurzelnde Grundangst unserer Zeit, dann müssen wir von diesem Bild zerfallender Ordnungen und geistiger Konzeptionen ausgehen. Sie betreffen nicht das
Abendland allein, sind doch die übrigen Kontinente im Begriff, sich auf diese
spätabendländischen, in sich nicht mehr gesunden Lebens- und Denkformen umzustellen. Es scheint, dass die Angst in der Welt, über die Welt heute mit gutem
Grund besteht.
Wir haben aber noch über einen anderen Aspekt zu sprechen, nämlich über
die Rolle, welche die Angst innerhalb des Christentums spielt und immer gespielt
hat, weil wir unser Thema ja nicht in einem ausschliesslich historischen oder philosophischen, sondern im christlichen Licht betrachten wollen.
In der christlichen Theologie gibt es viele Richtungen, viele zeitbedingte
Denkmoden, viele diskutierte und diskutierbare Interpretationen. Stellt man also
die Frage, ob der Mensch in der Grundsituation der Angst zwangsläufig zu leben
habe, so wird es verschiedene Abtönungen in der Antwort geben. Nämlich solche,
die das ohne weiteres zugeben; solche, welche die Angst „auch" der Grundsituation des Menschen zuordnen, und solche, die auf die Alternative der „Hoffnung"
hinweisen. Darf ich Ihnen, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich irre (was im
Hinblick auf die Sache nur erfreulich wäre), dass ich mich als Nicht-Theologe irre,
zu diesem Thema etwas Deutliches sagen? W a r u m hat die christliche Theologie
und insbesondere die protestantische Theologie, eine solche Affinität zur Angst?
Soll nicht das Christentum die „frohe Botschaft" verkünden?
Folgt man Kierkegaard in seinem grundlegenden Werk „Der Begriff Angst",
dann leitet sich die Angst vom Bewusstsein der Sündhaftigkeit ab. Der Sündenfall habe den Menschen von Gott abgesondert, habe Gottes Zorn auf ihn gelenkt,
h a b e ' i h m die Erbsünde angehangen ihn um sein gutes Gewissen gebracht. Das
permanente schlechte Gewissen sei gleichbedeutend mit dem permanenten Grundgefühl der Angst. Die Angst ist, «ach Kierkegaard, die Wirkung der Sünde.
An dieser Stelle möchte ich zur Vermeidung von Missverständnissen einen
Unterschied setzen zwischen dem unserer Kirche so vertrauten Begriff der „Gottesfurcht" und dem der „Angst". Wenn Martin Luther im Kleinen Katechismus
die Erklärung der zehn Gebote immer wieder anheben lässt mit den Worten „Wir
sollen Gott fürchten und lieben", dann ist etwas anderes gemeint, Furcht etwa
so wie „Ehrfurcht", also mehr im Sinne von Respekt, von unbedingter Anerkennung, nicht aber, dass wir vor Gott Angst haben sollen.
Wir sagten, dass im Christentum, so wie es im L a u f e der Geschichte geworden ist, ein Element der Apgst mit enthalten ist, und dass diese Angst mit dem
Dogma von der Erbsünde zusammenhänge. In der Bibel steht viel von der Sünde, aber das Dogma von der Erbsünde, d. h. von der absoluten und unabwendlichen, prinzipiellen Sündigkeit des Menschen ist erst später entstanden; wenn ich
richtig unterrichtet bin, geht es auf Augustinus zurück. Dem frühen Christentum war es nicht bekannt oder wurde zumindest nicht so scharf formuliert wie
später. Wenn es nämlich bei Paulus im Römerbrief, 5. Kapitel, heisst, dass „durch
22
eines Menschen Sünde (Adams) die Verdammnis und der Tod über alle Menschen kommen ist", so geht es Paulus an dieser Stelle gar nicht darum, diesen
Sachverhalt als solchen zu postulieren, wie in späteren Jahrhunderten das Dogma
von der Erbsünde postuliert wurde, sondern er benutzt diese Aussage dazu, um
umso klarer und umso schärfer die Grösse von Jesu Erlösertat aufzuzeigen, durch
welche die Verdammnis überwunden wurde.
Wenn also die Erbsünde durch Christus überwunden wurde, wieso konnte
sie in den späteren Jahrhunderten eine so zentrale Rolle übernehmen? Während
unserer gemeinsamen Tagung über das Dogma haben wir uns über die Rolle unterhalten, die die Geschichte in der Ausprägung unseres Glaubensbekenntnisses
spielt. Seit Konstantin dem Grossen übt das Christentum eine weltliche Aufgabe
als Ordnungsfaktor im Staate aus. Mehr und mehr geht es den nachfolgenden
Jahrhunderten um die Aufrichtung von Ordnung und Autorität, also, biblisch
gesprochen, um die Aufrichtung des Gesetzes. Über dieses grandiose Unternehmen
des Mittelalters darf nicht gering gedacht werden. Doch uns trennen schon Jahrhunderte davon, und aus der geschichtlichen Perspektive heraus können wir vielleicht verstehen, wieso die Angst im Glaubensgut der Kirche einen Platz haben
konnte. Wo es um Ordnung und Autorität geht, ist immer ein Element der Einschüchterung notwendig. Das Bewusstsein der Sündhaftigkeit machte den Menschen zum Gehorsam bereit. Gerade im Rahmen der Erörterung des Sündenfalles
sagt Augustin im ,¿Gottesstaat": „Gottes Vorschrift verlangt Gehorsam, und diese Tugend ist die Mutter und Hüterin aller Tugenden. Denn so ist alle Kreatur
geschaffen, dass es ihr nützlich ist zu gehorchen, verderblich aber, den eigenen
Willen zu tun." Und dieser, der eigene Wille, ist folgeric'htigerweise bei Augustin
die Sünde selbst. Kaum jemand kann beurteilen, wie richtig dies ist, als wir
heute, nachdem der menschliche Wille einige Jahrhunderte lang seinen autonomen Weg gegangen ist. In der geistigen Welt des Mittelalters aber mit ihrem
hierarchischen Stufenbau, dieser Pyramide der Werte, nach ihrer Heiligkeit geordnet, fühlte sich der Mensch durch die Sünde an die untersten Stufen gekettet.
Dieses Bewusstsein, dass der Mensch der Sünde verhaftet war, der Sünde mit
ihrer ungeheuerlichen Bedeutung f ü r den Menschen, war die Quelle der Angst.
Und diese Angst war, um Augustinus nun, nicht übelmeinend sondern lediglich
der Klarheit halber zu persiflieren, den organisierten „Hütern aller Tugenden",
nämlich der Kirche und den Staaten, „nützlich". Insofern w a r die Angst ein notwendiges Element der mittelalterlichen Welt und ist es noch heute überall dort,
wo es um die Aufrichtung einer straffen Autorität geht.
Das ist ein weiter Weg seit Paulus! Damit möchte ich das Problem der Sünde nicht bagatellisieren. Die Situation der Sündigkeit hat auch im nachmittelalterlichen, protestantischen Bekenntnis eine ganz scharfe Formulierung gefunden,
so im Augsburger Bekenntnis, wo es heisst, die Menschen seien vom Mutterleibe
an voller böser Lust und Neigung und könnten von Natur keinen wahrhaften
Gottesglauben haben. Wir wissen, wie bitter Luther vom Gefühl seiner Siündigkeit gepeinigt wurde. Die äusserste Spitze wurde in der Konkordienformel erreicht, wo es von uns allen heisst, dass wir um der Sünde Adams und Evas willen
,,in odio dei" seien; wozu noch zu sagen wäre, dass diese Bestimmung eines
23
„hassenden Gottes" wohl dort formuliert, gleichzeitig aber zu denken verboten
wurde, was ihre ganze Ungeheuerlichkeit aufzeigt.
Diese Überlegungen mögen uns verhelfen, neben der aus dem Zustand der
Welt entspringenden Angst auch diejenige Angst zu verstehen, die in unsrer Religion selbst wurzelt. Wenn ich dieser letzteren einen historischen Charakter gebe
und sie damit gleichsam von uns distanziere, als zum Mittelalter gehörig, dann
meine ich das nicht absolut und will nicht sagen, dass diese theologisch motivierte
Angst mit dem Vorübergehen des Mittelalters dahin sei. Diese Dinge, die zum
Gehalt unseres Glaubens selbst .gehören, verschwinden nicht, es verschieben sich
lediglich die Akzente. In der Tagung dieser Akademie über das Dogma wurde
schon einmal der Gedanke ausgesprochen, dass die Überzeugung von der Sündhaftigkeit f ü r den Mensehen der Neuzeit zwar nicht verschwunden sei, aber dcch
viel von ihrer Bitterkeit verloren habe.
Im gleichen Sinne -kann man sagen, dass der mittelalterlichen religiösen
Angst, die dem hierarchischen und autoritären Weltgefüge wesensgemäss war,
auf der positiven Seite eine andere Kategorie entsprach, die ebenfalls zum festen Bestand unserer ¡Religion gehört, nur dass sie damals einen stärkeren Akzent hatte. Es handelt sich um die — damalige — Antithese zur Angst, um die
Hoffnung. Wie gesagt ist es nicht meine Absicht, die Hoffnung zu etwas Mittelalterlichem abzustempeln. Diese Dinge lassen sich selbstverständlich in keiner
Weise abstempeln und alle Darlegungen wie diese können nur einen hinweisenden
Sinn und Wert haben. Sündhaftigkeit und Angst auf der einen Seite, ihnen entsprechend auf der anderen Gnade und Hoffnung; das ist etwa das Bild. Freilich
.eines, das jederzeit seinen Platz in unserer Religion hat, damals aber von ganz
besonderer Bedeutung war. In der Hoffnung ist noch etwas Angst enthalten, weil
in ihr immer ein Teil Ungewissheit mitschwingt. Sie ist wohl die Antithese zur
Angst, aber in Anbetracht der Sündigkeit des Menschen weiss letzten Endes niemand, ob pr, selbst bei aller Askese, wirklich der ewigen Seligkeit teilhaftig wird.
Wie sehr sich die Akzente in diesen Dingen verschieben, können wir ganz
kurz daran sehen, wie sie in einer ebenfalls heute schon vorübergehenden Periode, nämlich der des bürgerlichen Idealismus, gesehen worden sind. Überhaupt
gäbe es viel zu sagen über die geschichtlichen Wandlungen des Begriffes Angst
und seiner Antithesen in den verschiedensten Epochen, doch sei das Phänomen
der Wandlung nur an diesem einzigen Beispiel noch skizziert, ehe ich wieder zu
unserer heutigen Situation zurueckkomme. Der bürgerliche Idealismus ibt jene
Zeil, die beinahe noch da ist und die wir darum, aus Mangel an Abstand, noch
kaum und auf keinen Fall umfassend und richtig zu begreifen vermögen. F ü r
den bürgerlichen Idealismus war, das kann man ganz prägnant sagen, die Angst
eine Schande, man hatte sie nicht zu haben. Welch ein Gegensatz zum Mittelalter,
dem ein solcher Gedanke als gottlose Vermessenheit erschienen wäre (ausser
im Bereich des Kriegerischen). Und so wie man die Angst nicht zu haben, infolgedessen zu unterdrücken und nicht weiter zu diskutieren hatte, so hatte man,
ganz folgerichtigerweise, auch keine - eigentliche Antithese. Es kann im Lichte
des Idealismus gar nicht von „Hoffnung" geredet werden, denn das Ideale hat
seinen Lohn in sich selbst, die Bemühung, die Tätigkeit selber ergeben Befriedigung. Das „eine Sache um ihrer selbst willen tun" ist sich selbst genug. Wir se-
hen schon, dass wir unserer eigenen Zeit nahe sind, obwohl sich vieles -merklich
verschoben hat.
Denn davon: eine Sache „um ihrer selbst willen" zu tun, sind wir heute
schon weit entfernt. Darf ich sie bitten es f ü r eine Weile hinzunehmen, wenn
ich sage, dass die Epoche des Idealismus vorüber ist; sie ist nämlich als Residuum
und vor allem in den Phrasen der Politiker, aber auch in den Selbsttäuschungen
unseres eigenen Inneren durchaus noch da, in manchen von uns sehr wahrscheinlich sogar noch so sehr „da", dass ihr Wirklichkeit und Wirksamkeit innewohnt;
es gibt ganz gewiss noch echte Idealisten. Auch hier möchte ich nichts abstempeln; wenn ich also vom Ende des Idealismus spreche, dann ist dies kein absolutes
Ende, so wenig wie die Wert-Hierarchien, die Heiligkeiten und Autoritäten des
Mittelalters je ganz erloschen sind. Man könnte diesen Sachverhalt so f o r m u lieren, dass gewisse geistige Inhalte vorübergegangener Epochen vor anderen zurücktreten, dass sie hintergründig werden.
Und nun wollen wir uns wieder dem Vordergründigen, also unserer eigenen
Zeit zuwenden, wobei dies sofort mit der Schwierigkeit anhebt, dass unsere Epoche noch gar nicht richtig begonnen hat. Insofern begebe ich mich jetzt ins Hypothetische und will dazu nur sagen, dass man in der Philosophie und Literatur
einen gewissen Konsensus über den Charakter dieser Epoche herauszufühlen beginnt, etwas sich also doch schon aussagen lässt. Besonders über unser Thema:
die Angst. Wir können uns auf dieses eine Phänomen beschränken.
Ganz gewiss ist heute nicht mehr der „bürgerliche" Mensch massgeblich und
stimmt es auch nicht, wie man manchmal behaupten hört, dass der Wohlstand der
Massen etwa in Europa oder den Vereinigten Staaten oder auch in Russland die
Proletarier „verbürgerliche". Ganz gewiss ist es umgekehrt, nämlich so, dass die
Gesellschaft proletarisiert, so wie es Qrtega y Gasset im „Aufstand der Massen"
dargestellt hat. Der dominierende Typ von heute ist der Arbeiter. Man braucht
dabei nicht so sehr an eine soziale Schicht zu denken, etwa an die „armen Arbeiter", das „ausgebeutete Proletariat", sondern an den Typ des Arbeiters wie
ihn Ernst Jünger charakterisiert, an den schaffenden Menschen, "den „homo faber", wozu also auch Manager und Staatsmänner, Generäle und sogar Schriftsteller gehören. Dieser neue Typ repräsentiert ein neues Weltverständnis, neue
persönliche Werte, und infolgedescen auch ein neues Erscheinungsbild der Angst.
Um den „home faber" unserer Zeit zu verstehen, müssen wir uns ganz kurz
seinen Entwicklungsgang vergegenwärtigen. Er ist das Endprodukt der „Neuzeit' , der Zeit des Rationalismus, der Naturwissenschaft und der Technik, die
auf das Mittelalter folgt. Während das Mittelalter das Metaphysische in alles einbezieht, so dass des Meeres Wellen und das Rauschen des Waldes und der Himmel
und alle Dinge, Zustände und Gefühle in ihrer Transzendenz, ihrer Verbundenheit
mit dem Übernatürlichen verstanden werden, hat die Neuzeit sie entkleidet, sie
messbar gemacht, sie auf das materielle oder energetische Skelett, auf das sinnlich oder vernunftmässig Erfassbare reduziert. Dem neuen Menschen ist kein
Rätsel mehr heilig, so dass er allem zu Leibe rückt. Das Verständnis aller kausalen Zusammenhänge hofft er in steigender Progression zu erreichen. Und das
Charakteristische ist, er hat sich von der Ehrfurcht vor den Welträtseln emanzipiert, er dringt mit analytischem Verstände immer mehr in sie ein. Hierzu be25
dient er sich der phänomenal entwickelten Technik. Mit ihr, der zum Werkzeug
gewordenen Ratio, „macht" er die Dinge, macht er alles. Das fundamentale Kennzeichen der neuen 'Epoche ist, dass in ihr alles „machbar" geworden ist. So werden heute nicht nur Industrieprodukte, Maschinen und Konsumgüter, sondern
ebensogut Länder und Grenzen, Kunstrichtungen, Nationalgefühle, Kollektivpsychosen, Philosophien und Weltanschauungen „gemacht".
Zur Verdeutlichung möchte ich darauf hinweisen, mit welcher Künstlichkeit
die demagogischen Volksverführer unserer Zeit irgendeinen „Ismus" zusammenkonstruieren und wie sie mit so etwas die Massen zu fanatisieren und f ü r ihre
Zwecke zu benutzen vermögen.
Hier sind wir auf dem richtigen Terrain, um zu verstehen, worin denn nun
die f ü r dieses Zeitalter typische und spezifische Angst gründet. Wenn alles „machbar" geworden ist, und ich benutze dieses künstliche Wort mit voller Absicht, um
den Sachverhalt schärfer hervortreten zu lassen — wenn alles „machbar" geworden ist und doch die Perfektion nicht Erreicht wird, erwächst die Angst eben aus
dieser Imperfektion, die Angst kommt aus dem Gefühl heraus, dass das Gemachte nicht nur nicht richtig, sondern in einem gefährlichen Sinne falsch sein kann.
Denken wir daran, dass heute ja nicht nur Menschen in den Weltraum geschossen werden können, um der Menschheit nie Geschautes zu erschliessen, sondern
dass auch die Vernichtung der gesamten Menschheit in den Bereich des „Machbaren" gerückt ist. Es bleibt in allen Gemachten immer ein Bestand des Unkontrollierbaren zurück: bei allem Fortschritt der Medizin und der Medikamente gibt
es immer weiter Krankheiten, ja immer neue Krankheiten: die Fortschritte des
Verkehrs bedeuten auch die Zunahme der Verkehrsopfer; die uhgeheure Macht
der Presse, Meinung zu „machen", bedeutet immer auch Missbrauch; und andersherum, keine Presse kann so „gemacht" werden, dass nicht immer auch eine
Gegenmeinung entsteht, wie es z. B. in allen totalitären Staaten in Form der Flüsterparolen geschieht. Kurz, das Gemachte, wie gut gemacht es auch sei, ist nie
vollkommen, und je mehr man sich auf das Gemachte einstellt, sich auf das Gemachte verlässt, umso bedrohlicher wird diese Unvollkommenheit, umso gefährlicher, umso angsterregender.
Gehe ich fehl, wenn ich sage, dass uns allen vor dieser modernen Welt, in der
alles gemacht ist, unheimlich zumute ist?
Aber bitte, es kommt hier ganz ausserordentlich darauf an, von welchem
Standpunkt aus ich den modernen Menschen kritisiere.
Es gibt: nämlich einen sehr verbreiteten Standpunkt des „Anti-Faber", der aus
einer romantischen Vorstellung über die Vergangenheit herkommt. Teils ist es
echt konservativer Geist, teils ist es bürgerliches Ressentiment, das darin zum
Ausdruck kommt, weil es gerade die bürgerliche Welt ist, die durch ihn ihr Ende
findet, Teils ist es geistige Trägheit, die sich zu allen Zeiten dem Neuen entgegengesetzt hat. Bedenken Sie eines: Den „home faber" kann man nicht verwerfen,
denn wie soll die Menschheit auf diesem sich geradezu stündlich dichter und dichter bevölkernden Erdball existieren können, ohne immer schärfere Rationalisierung, Reglementierung, Organisation und Technik?? In einer reglementierten
Welt ist wenig oder kein Platz f ü r Originale, Aussenseiter und Querköpfe, das ist
gewiss sehr bedeuerlich, aber es ist unvermeidlich. Es bedeutet nicht, dass Cha26
rakter und selbständige Intelligenz keinen Platz hätten, aber es bedeutet, dass
diese „mit-machen" müssen, sich in das Gemachte eingliedern, sich die Beschränkung gefallen lassen müssen, die unser noch vorhandenes, bürgerliches Ich heute
sc schmerzhaft empfindet, weil das Vergangene eben noch nicht ganz verganger ist,
Wenn wir den „homo faber" nun in diesem Sinne akzeptieren, erkennen wir
auch die seinem Typ zugehörige Angst als die unsrige. E s ist die Angst, die aus
der Erkenntnis der Imperfektion der materiellen Welt entspringt, in der, trotz
aller scharfsinnigen Kontrolle, doch immer etwas schiefgeht, ja, wo das vom
Menschen mit so viel Mühe und offenbarem Erfolg Geschaffte auch jederzeit eine
Waffe in der Hand des Bösen ist. Diese aus der Erkenntnis der Grenze des Rationalen entspringende Angst ist ebensosehr wie jede andere, frühere Angst ein
Finger Gottes, dazu angetan, den Menschen auf den richtigen Weg zu führen.
Dar! ich hier etwas Wichtiges einflechten? Die Angst ist, wie alles dem Einzelner oder der Gesamtheit Auferlegte, etwas sinn- und wertvolles, sie ist eine
Hilfe. Nicht adäquat, nicht das richtige Verhalten wäre es, die Angst beiseitezuschieben oder zu verachten. Man muss sie ernst nehmen als ein Zeichen, als einer Hinweis, als Ansporn, etwas zu tun.
Ich sagte, dass die Angst des modernen Menschen ihren Grund darin hat,
dass er dabei ist. sich eine perfekt funktionierende Welt zu „machen", gleichzeitig
aber dauernd die Unvollkommenheit alles „Gemachten" erfährt. Wurde also der
mittelalterliche Mensch vom Gefühl seiner moralischen Unvollkommenheit bedrückt, sc leidet der moderne Mensch an der Unvollkommenheit seines rationalen Kalküls.
Die Kunst der letzten Jahrzehnte, sofern sie Sensibilität, Antenne ist f ü r
den Zustand der Zeit, spiegelt diese Angst, diesen Pessimismus wider. Man spricht
immer häufiger vom „verlorenen Bild des Menschen", vom „Verlust der Mitte",
vor; der „Dehumanisierung" oder wie nun ein jeder diesen Verlust bezeichnet. Es
ist sehr schwer für uns, soweit wir als „bürgerliche Menschen" empfinden, also
noch Mitglieder jener zuendegehenden Epoche sind, uns dieser pessimistischen
Auffassung zu entziehen. Stösst man doch überall auf ihre unübersehbaren Auswirkungen. Trotzdem aber muss man den Schritt nach vorne tun. Ich bin ganz
sicher, dass wir, ebensosehr wie wir noch der vergangenen Epoche zum Teil angehören, zum anderen Teil alle schon Mitglieder der kommenden Epoche sind,
Wer weiss, wo die Geschichte später einmal die Grenze setzen wird, wenn überhaupt in der kommenden Welt, die aller Wahrscheinlichkeit nach eine einzige,
alle Kontinente umspannende Einheit sein wird, noch ein solcher Wert auf Geschichte und Geschichtsdeutung gelegt werden sollte wie heute. Die Zukunft hat
schon begonnen, heisst ein Buch, das, wie die meisten solchen Bücher aus dem
deutscher Sprachraum. Entsetzen vor dieser Zukunft empfindet. Obwohl wir
schon in ihr leben, können wir uns auf ihr Lebensgefühl noch nicht einstimmen.
Kaum dass wir über ihr Aussehen und ihr Wesen mutmassen können. Aber lassen Sie mich mein Thema auf der Basis dieser Mutmassungen weiterspinnen,
denn die Überwindung der Angst liegt in der Zukunft.
Dem mittelalterlichen Menschen mit seinem Gefühl der moralischen Unvoll27
kommenheit bot sich als Lösung die göttliche Gnade, die göttliche Liebe. Auf sie
gründete er die Hoffnung.
Dem Menschen der Zukunft mit seinem Gefühl der Unzulänglichkeit des rationalen Handelns und Planens eröffnet sich als Lösung das Wissen um die Vollkommenheit des göttlichen Weltplans.
Hier möchte ich einflechten, dass es sich nicht um ein Entweder/Oder handelt. Nicht dass Gottes Plan an die Stelle der Liebe tritt und sie ersetzt. Das eine
sehliesst das andere nicht aus. Es ist aber so, dass die Realität Gottes aus der
neuen Situation des Menschen heraus ein wenig anders gesehen wird, aus der
ganzen Fülle wird eine neue Eigenschaft, eine neue Wirkungskraft sichtbar. Wir
dürfen uns zunächst darauf freuen, dass die kommende Welt mit ihren gewandelten Auffassungen neue Gottesgaben, neue Hilfsquellen von Ihm her entdecken wird. Was wir schon wussten, erfahren und erlebt haben, geht nicht verloren,
aber Neues kommt hinzu.
Bleiben wir auf dem Boden des Gegenständlichen. Denken wir daran, wie
weit die Grenzen der erforschten und erklärten Materie hinausgeschoben worden
sind. Bedenken wir, dass das durch die Naturwissenschaft und Psychologie geschulte Denken eine ganz neue, geschärfte Erkenntnisfähigkeit besitzt, die sehr
wohl auch dazu dienen kann, das Metaphysische als eine besondere Dimension,
als einen Kosmos im Kosmos zu begreifen. Die neue Menschheit 'will sehen, sie
ist aufgeschlossen, vielleicht könnte man sagen neugierig. Sie hat sich vorzügliche Organe, des Verstehens, des geistigen Ordnens zugelegt. Das sind bemerkenswerte Fähigkeiten. Die Menschheit baut an einer Welt, die wie eine perfekte Maschinerie reibungslos arbeiten soll. Mit Verlaub, die kommenden Generationen
werden eine solche Welt brauchen, wenn sie weiterleben wollen'- Können wir
überhaupt daran zweifeln, dass Gottes Plan eine solche perfekte Welt längst vorgesehen hat?
Nun aber Halt, werden viele von Ihnen sagen. Ist es denn nicht gerade so,
dass die Welt unvollkommen ist und wir von ihr erlöst werden sollen? Sehen Sie,
hier liegt die grosse Aufgabe f ü r die kommenden Generationen, die mit uns schon
beginnen. Es ist nicht einfach, diese Dinge in Worten auszudrücken. Ein wegen
seiner Frömmigkeit berühmter Mensch hat einmal gesagt: „Die Schwierigkeit
liegt darin zu verstehen, was Gott ist." Auch die Angst erschöpft sich nicht in den
dürren, theoretischen Definitionen, die ich bisher von ihr gegeben habe. Sie ist
etwas ungeheuer Lebendiges, das einen anspringt aus dem Dunkel, etwas Körperliches, das den Herzschlag lähmt, kalten Schweiss ausbrechen lässt, das Denken behindert. Sie kommt von unten her, aus dem Unterbewusstsein, und legt
sich dem Vernunftdenken auf, Vom Unterbewusstsein her übt die Angst ihre kalte, lähmende Macht aus. Darf ich an dieser Stelle als Antithese zum Unterbewusstsein den Begriff eines „Über-Bewusstseins" setzen? Ich meine damit ein höheren Bewusstsein als das alltägliche, ein Organ zur Aufnahme der höheren Dinge, die über die materielle Realität hinausgehen. Dieses höhere Bewusstsein versteht Dinge, f ü r die Worte nicht ohne weiteres ausreichen, es verfügt d a f ü r über
eine Vorstellungswelt aus Hinweisen und Symbolen. Poetische Bilder sagen ihm
mehr als logische Deduktionen. Jesus lehrte seine Jünger in Gleichnissen. Heute
würde er es wahrscheinlich weniger nötig haben, geistige Tatsachen in der schwie28
rigen Sprache einfacher Gleichnisse auszudrücken, die einer Deutung bedürfen.
Eine jahrhundertelange Schulung in der Bewältigung abstrakter Probleme befähigt uns, die geistigen Wahrheiten des Seins in direkterer Form aufzunehmen.
Die Essenz der Wahrheit kann jedoch nicht in Worten ausgedrückt werden. Auch
besagen unsere intellektuellen Fortschritte nicht, dass wir diese Wahrheiten darum zwangsläufig besser verstehen müssten. Denn das Verständnis f ü r die Dinge
des Glaubens liegt auf einer höheren Ebene, und Jesu Gleichnisse sind von den
Jüngern und allen späteren Geschlechtern immer nur' k r a f t eines Aufschwunges
auf jene höhere Ebene verstanden worden.
Die in Gottes Plan vorgesehene perfekte Welt ist mit simplem materiellen
Denken nicht zu verstehen, aber auf jener höheren Ebene ist sie als Idee, als Leitbild evident. Wenn wir lernen,"die Wahrheiten der höheren Ebene — auf ihr gibt
es nur und ausschliesslich Wahrheit — als Werkzeuge zur Ordnung und Meisterung der Welt, wenn wir die Probleme der Welt auf jene höhere Ebene hinaufführen und sde dort lösen, dann erfüllen wir als Christen dieser Zeit die uns aufgegebene Mission. Auf dem niedrigen Terrain menschlicher Begierde und Rechthaberei lässt sich kein Problem lösen, aber jedes Problem kann gelöst werden,
nein, wird für uns gelöst, wenn wir es hinaufheben ins Licht der höheren Weisheit.
Wer gewohnt ist, die Dinge des Glaubens ausser Zusammenhang mit den
Dingen der Welt, gleichsam nur in der Sphäre pietätsvoller Stimmungen zu sehen, wird schockiert sein, sie hier als Werkzeuge zur Meisterung der weltlichen
Probleme aufgefasst zu finden. Aber dieser Gesichtspunkt ist unbedingt der des
heutigen Menschen, f ü r den, aus dem Umgang mit der Technik, der Nutzeffekt
eine grosse Rolle spielt. Ihn wird es ansprechen, wenn man ihn auf die gewaltige
Kraft aufmerksam macht, die in Gottes Wort verborgen ist. Gottes Kraft — das
ist ein Gedanke, der den heutigen Menschen zu begeistern vermag — Gottes Dynamik, Energie, ein unerschöpfliches Reservoir. Der heutige Mensch denkt vorwiegend in der Kategorie des Nutzens, das ist eine Tatsache, über die viel geklagt
wird. Aber Klagen ist zwecklos. Er muss es. Es gehört zu seiner historischen Situation, und Gott wird ihn in dieser Situation nicht allein lassen, so wenig er in
irgendeiner Epoche den Menschen allein gelassen hat.
Wer nun wieder die „Nützlichkeit" des göttlichen Wortes in simpel materiellem Sinne verstehen will, der kann sie nicht verstehen. So ein Wort will im dahinterstehenden religiösen Sinn verstanden werden, ohne diesen ist es freilich Schall
und Rauch.
Der Mensch unserer Zeit hat in diesem Sinne viel zu lernen. Und er wird lernen. Er wird lernen, f ü r die bereitstehende göttliche Planung einen ganz wachen
Sinn bekommen, wenn er erst einmal erkannt und erfahren hat, dass diese, und
nur sie, ihm dazu verhelfen kann, die Welt zu meistern. Ich möchte an dieser
Stelle aussprechen, dass 'ich nicht meine, hiermit ein blosses Wunschbild oder Postulat auszusprechen. Wir wären keine Christen, wenn wir an der Kraft des göttlichen Wortes zweifelten, wenn wir an der Kraft seines Geistes, seiner Führung,
seines Planes zweifelten. Die Lehren Jesu und der Propheten sind dieser Plan,
kein Stoff, dem wir uns nähern, indem wir uns geistig um Jahrhunderte zurückschrauben, aus reiner Pietät, aus blossem Respekt. Es ist das Problem unseres
29
eigenen Lebens. Christus ist immer noch der Weg, und der Weg f ü h r t in die Zukunft.
Die Welt wird nicht gemeistert durch die Selbstherrlichkeit des Menschen.
Der Mensch ist nichts, wenn er sich nicht in Demut in Gottes Plan eingliedert.
Der vollkommene Mensch ist der selbstlose Mensch. Nicht der blinde Wille, sondern das Hinhorchen, das Einstimmen auf den göttlichen Willen bringt uns weiter.
Unser« Epoche ist energisch dabei, den Persönlichkeitskult fallen zu lassen. So
wird das in der Bergpredigt Gesagte aktuell: jene in den letzten Jahrhunderten
im Abendland so herausgestrichenen „Ersten", eben jene Persönlichkeiten um
die man einen Kult trieb, sie werden die Letzten sein. Die w a h r h a f t Ersten sind
diejenigen, die sich selbst zurückstellen. F ü r diese Gedanken ist unsere Zeit hellwach, es sind ihre Gedan-ken. In der herankommenden Welt ist f ü r den Eigenwillen, f ü r das Risiko des siegfriedhaften I r r t u m s ' kein Platz (ich nehme bewusst
Siegfried als ein Beispiel der bewunderungswürdigen Persönlichkeit, der aber
der Sinn abgeht f ü r die Einordnung und die sich darum zum Unheil ihrer Mitmenschen auswirkt). Die Heilige Schrift ist keineswegs ein alter Papyrus, dem
man um seines Alters willen Verehrung zollt. Sie ist ein höchst aktuelles' Buch,
ein nützliches Buch. Mehr als das, sie wird jetzt, aus einer gesteigerten Notwendigkeit heraus, ganz besonders aktuell.
Und sprechen wir nun wieder von der Angst, die f ü r uns aus der Erkenntnis
der Unvollkommenheit der Welt entspringt. Wenn wir lernen, die höhere und
eigentlichere Realität der göttlichen Absichten anzuerkennen und unsere P r o bleme in ihrem Lichte behandeln und bearbeiten, werden wir gleichzeitig damit
erfahren, dass diese Angst von uns genommen wird. Denn die Unvollkommenheit,
d. h. das Falsche und Irrige, menschlich Beschränkte verschwindet in dem Masse,
wie die Dinge gut, d. h --m Einklang mit den göttlichen Geboten getan werden.
Dies ist eine ganz einfache Erfahrung, die jeder machen kann oder schon gemacht
hat. Dem Christen, dem der Weg zum Heil gewiesen ist, kann die Angst nur ein
Stachel sein, er muss sie hinter sich lassen. Wenn wir daran denken, dass Gott nach
der Schrift den Menschen geschaffen hat „nach seinem Bilde, zu herrschen über
die ganze Erde", wird uns klar, dass die Furcht unbegründet ist, so lange der
Mensch sich einstimmt auf Gottes Wort und Absicht. Der moderne Mensch wird
sich nicht mit der Hoffnung zufriedengeben, die vage und unbestimmt ist. Er
wird nach Gewissheit streben. Er wird Gottes Wort auf die Probe stellen. Er ist
im Grunde, in der Anlage, nicht schlecht vorbereitet. Er wird sich (immer in
der geistigen Dimension gesehen, in die diese Dinge hineingehören) die Wahrheit
erarbeiten, vor Arbeit scheut er nicht zurück. Mehr als frühere, fatalistische, von
Aberglauben erfüllte Jahrhunderte ist die klare L u f t des prüfenden, analysierenden Zeitalters neu, eine neue Herausforderung. Ich bin überzeugt, dass diese
und kommende Generationen mit einem tiefen, aufrichtigen und aufgeschlossenen Sinn fragen und fordern, bohren und nicht ruhen und rasten werden, bis sie
zum Verständnis durchdringen. Wenn auch dieses Verständnis nur erlangt wird
auf dem geheimnisvollen Wege, auf welchem die Menschen immer und zu allen
Zeiten zum Glaubensverständnis gekommen sind, so werden diese kommenden
Generationen doch viel aufgeschlossener und aufnahmebereiter sein als wir Men30
sehen der Übergangszeit es uns vorstellen können, einfach aus einer totalen geistigen Reinigung und Objektivität heraus.
Die Menschen suchen Gottes Willen, Gottes Plan zu verstehen, um mit seiner
Hilfe die unvermeidliche, unaufschiebbare, funktionierende Organisation
der
Menschheit auf Erden zu verwirklichen. Christi Lehre ist, so wie sie ist und ohne
ein Jota zu ändern, das Werkzeug f ü r diese Aufgabe. Nicht der Eremit, der Klosterbruder, sondern der schaffende und gestaltende, dabei aber dienende und sich
einordnende Mensch, das ist der gläubige Mensch der Zukunft, und so wie ihm
Gottes Wort und Weisung zur Gewissheit werden, wird er die Angst dieser Zeit
überwinden.
31
SIEGWART BERENDES — Santiago
„Religion ohne Entscheidung"
Zu dem gleichnamigen Buch von Hans-Otto Woelber
Im Jahre 1959 erschien ein Buch mit dem Titel „Religion ohne Entscheidung"
von Hans-Otto Woelber, das den Vorgang und das Ergebnis einer representativen
Befragung von 2000 Jugendlichen der Bundesrepublik der Altersgruppe zwischen
15—24 Jahren durch das EMNID-Institut wiedergibt. Solche Befragungen sind
nicht ungewöhnlich. Diese aber sticht durch ihren Gegenstand heraus, nämlich
die religiöse Situation der Jugend statistisch zu erhellen. Es erheben sich Einwände, etwa dass der Glaube so subjektiv sei, dass er statistisch nicht erfasst werden könne, oder dass dieses Unternehmen ein Eingriff in die tiefsten und deshalb
intimen Bereiche des Menschen sei, welches verletzen müsse. Weil diese Fragen
schon ein Teil des Ergebnisses sind, und die Einstellungen zu diesen Einwänden
schon einen Teil der religiösen Situation wiederspiegeln, die in dem Ergebnis der
Befragung statistisch dargestellt ist, sollen sie in einem ersten Abschnitt besonders zu Wort kommen.
Diese Überlegungen werden in folgender Richtung vorgehen: „In unserem
Zeitalter der säkularisierten und rationalisierten Lebensform ist die Religiosität
ausschliesslicher ajs je zuvor eine Sache der schwer zugänglichen seelischen Intimsphären geworden. Nur in mehrfacher Brechung dringen sie nach aussen.
Hier liegt die Hauptschwierigkeit, auf die heute jeder Versuch einer Erforschung
der Verhältnisse von moderner Mentalität und christlicher Glaubensverkündigung
stösst." (Nikolaus Menzel, Internationale Biographie, zit. bei Woelber. S. 23/24)
Nun hat gerade diese Untersuchung sich in dieser Richtung besonders bemüht,
gleichsam mit statistischen Mittein „den Schritt in die Dimension des Geistes zu
wagen" (S. 25). Mit einem Fragebogen von 100 Fragen, der durch eine eingearbeitete Person des Instituts den Jugendlichen vorgetragen und so gemeinsam
beantwortet wurde, sind nicht nur in direkter Anfrage die Glaubensaussagen ermittelt worden, sondern durch verdeckte Kontrollfragen, gedankliche Assotiationen etc-, gerade die Schichten angegangen, die nur gefühlsmässig mitschwingen
und im Emotionalen verankert sind. Bis in die Art und Weise, wie die Antwort
erteilt wurde, ob sie zögernd oder spontan erfolgte, wurde der Gradmesser des
Interviewers eingestellt. Dass theologisch manche Fragen offen bleiben, wie weit
sich der Glaube als Ereignis des Heiligen Geistes immer wieder dem statistischen
Erfassen des Menschen entzieht, ist auch den Initiatoren deutlich gewesen. Mali
könnte die Frage stellen, ob hier nicht das Verbot Gottes an König David gilt, der
in einer gross angelegten Zählung einen Überblick über seine militärischen Kräfte. die in Israel auch immer gleichzeitig das „Gottesvolk" bedeuteten, bekommen
wollte, und dafür von Gott bestraft wurde. Die Stärke und das Wirken von Gottes
Geist lässt sich nicht statistisch festhalten. Gott lässt sich nicht in Zahlen fangen.
(2. Sam. 24). Diesen Sachverhalt als Obersatz zugegeben, will die Untersuchung
deutlich machen, dass Gott sich in Jesus £hristus unter das Gesetz unterworfen
h a t das eben ein menschliches Gesetz ist. Jesus Christus w a r Gott u n d Mensch.
Dieses Bekenntnis, das logisch nicht auflösbar ist, gelte von dem Wirken des Geistes in gleicher Weise. Main muss sagen, der Geist kann wirken, „wo und wann
er will" (Coni. Aug. Art. 5). Aber neben diesem, ersten Satz steht, logisch nicht
auflösbar, der andere, dass dieser Geist in der .psychologischen und soziologischen
Gesetzmäsigkeiten unseres Menschseins iwirkt, und nicht ausserhalb, so wie in Jesus dem Zimmermannssohn aus Nazaretz Gott selber erschien. Was f ü r die Christologie gilt, hat auch f ü r die Ecclesiologie Gültigkeit. Die als ultima-ratio-Formel
von der Kirche erarbeitete Aussage über Christus, dass seine göttliche und menschliche Natur „ungetrennt und unvermischt" zu betrachten seien, wird von Woelber
entsprechend auf den Glauben der Gemeinde angewandt. „Die göttliche Natur
des menschlichen Glaubens ist nicht abhängig von der menschlichen Natur in irgendeiner Weise des Bedingtseins. Sie ist aber doch ganz und gar von der menschlichen Natur ungetrennt," CS. 259).
Theologie und Anthropologie haben miteinander zu tun, weil die Theologie
um das Geheimnis der Menschwerdung Gottes kreist, und die Anthropologie nicht
vorurteilsfrei arbeitet, sondern immer Werturteile einfHessen lässt; sie weist in
aller ihrer Arbeit über sich hinaus, indem sie die Frage nacfi dem Wesen des
Menschen stellt. Sc gesehen, wird es doch eine entscheidende Aufgabe der Theologie sein, die sozialen und psychologischen Gegebenheiten des Menschen zu erkennen und ernst zu nehmen. „Um der Fleischwerdung der Geheimnisse willen
geht es entschieden um den Glauben der menschlichen Kreatur und nicht um den
Glauben von Phantasiegeschöpfen." (S. 267)
Sc wird in dieser Untersuchung die menschliche Seite des Glaubensereignisse
zur Darstellung gebracht, wie sie heute erscheint. Wenn wir den Glauben als den
Glauben, den Gott wirkt und schenkt, nehmen, dann kann es sich bei ihm nicht
um eine im Verborgenen zu haltende Intimsphäre handeln, denn Gott will offenbar
werden und nicht sich verstecken.
Anschliessend sollen nun einige markante Ergebnisse dargestellt werden. In
folgender Überlegung scheint mir eine Berechtigung dazu zu liegen.
Die lutherische Kirche in Chile ist aus der „Deutschen Evangelischen Kirche
in Chile" hervorgegangen. Ihre Gottesdienst- und Unterrichtssprache ist Deutsch,
mit Ausnahme der sich mehr häufenden Kasualien in Spanisch. Sie hat das Wort
deutsch in ihrem Namen immer stark betont; sie stellt damit einen wichtigen
Faktor im deutschen Leben in Chile dar. So bestand und besteht heute ein starkes
Interesse an den kirchlichen Vorgängen in Deutschland.
Dieses Interesse hat zwei Seiten. Einmal ist es nach rückwärts gerichtet, etwa
so wie man an der alten Heimat hängt und sich gerne von dem Ergehen die®'
Schule und der Stadt erzählen lässt. So möchte man auch immer wieder von den
33
kirchlichen Verhältnissen in Deutschland hören, und etwas miterleben von den Erlebnissen an den Kirchentaigen oder Anteil nehmen an den schweren Problemen
der Gemeinden im Osten des Vaterlandes.
Wesentlich mehr im Vordergrund steht eine andere Überlegung. Im Laute
der Geschichte des Deutschtums in Chile hat die Kirchengemeinde eine wesentliche Rolle gespielt. Neben der Schule war sie die Stätte, in der die deutsche Sprache gepflegt wurde. Die Verbindung zwischen Verkündigung
des Evangeliums
und deutscher Predigt ist so fest, dass es Stimmen gibt, die grundsätzlich zweifeln, ob das Erbe der Reformation in spanischer Sprache weitergegeben werden
kann. Diese Haltung hat die Meinung der chilenischen evangelischen 'Kirchen
über die lutherische Kirche so beeinflusst, dass sie sie nur als fremdsprachige,
eben deutsche Kirche ansprechen, zu der man Eds Deutscher automatisch gehört,
zu der man sich aber nicht entscheiden kann wie zu irgendeiner anderen. Sie wird
von ihnen als eine Art Fremdkörper im Raum der evangelischen Welt
Chiles
empfunden. So erwartet man von ihr andererseits auch keine „Mission". Lutherisch kann man nur sein, wenn man deutsch ist und deutsch spricht. Das Moment
der Sprache und der historischen Tradition, ist oft stärker betont worden als die
Konfession. Umgekehrt galt nun auch, dass das Moment der Entscheidung angesichts verschiedener Konfessionen kaum in das Leben der Deutschstämmigen eintrat, da sie auf Grund der väterlichen Tradition selbstverständlich in dieser einen
Kirche ihre Heimat zu finden hatten. Wer sich anders entschied, galt als Aussenseiter oder Sonderling, wenn man ihm nicht gar das Übertreten des vierten Gebotes vorwarf.
Dieser Tatbestand hat zur Folge gehabt, dass sich ein festes Verhältnis zwischen dem Deutschtum Chiles und der evangelischen Kirche herausbildete, sowohl
nach der einen als auch nach der anderen Seite. Ganz gewiss hat die Kirche durch
ihre beharrliche Haltung in der Sprachenfrage zugunsten des Deutschen einen wesentlichen Anteil an der Formung des Deutschtums und der deutschen Gemeinschaft. Sie gilt als ein Kulturträger deutscher Art in Chile. Aber das hatte zur
Folge, dass sie umgekehrt in ihrer Arbeit und Gestallt ebenso von kulturellen
Faktoren der deutschen Gemeinschaft geprägt wurde. Eine Reihe von evangeliumsfremden Forderungen traten an sie heran, die sie auch a u f n a h m und sc weit
als möglich verwirklichte. In dieser „Kulturarbeit" umfasste sie aber nicht nur
alle : die von ihrem unruhigen Gewissen getrieben, der Botschaft des Evangeliums
begegnen wollten und die Barmherzigkeit Gottes suchten, sondern alle an der
deutschen Gemeinschaft Interessierten, die es für eine wichtige Aufgabe hielten,
deutsche Sprache und Tradition zu pflegen. Dieser Kreis war vielleicht grösser,
zumindest anders geartet als der erste. Man kann insofern von einer Volkskirche
reden. Sie war die Kirche der deutschen Gemeinschaft. Dem zweiten Verhältnis
von deutscher Gemeinschaft und evangelischer Kirche gilt unser Augenmerk. In
diesem Sinne kann man eine Parallele ziehen zwischen der Entwicklung der Volkskirche in Deutschland und der Situation, wie sie sich als Folge der Beeinflussung
der Kirche durch die Deutsche Kulturarbeit in Chile ergeben hat. So halte ich
die Ergebnisse der EMNID-Untersuchung in vieler Beziehung f ü r stichhaltig auch
für chilenische. Verhältnisse. Das Buch Woelber's trägt den Untertitel „Volkskirche am Beispiel der jungen Generation". Der in der deutschen Jugend sich wie34
derspiegelnde Spannungsbogen zwischen einer religiösen Offenheit und Erwartung aui breitester Ebene und der Verwirklichung religiösen Lebens in den fest
ausgeprägten Formen der kirchlichen Gemeinde ist deutlich auch unter der deutschen Jugend Chiles wieder zu finden. Wie die Untersuchung Woelber's deutlich
machen will, spiegelt die Jugend in diesem Bild die Situation der gesamten Kirche
und des Volkes wieder
Das sollen die folgenden Zeilen entfalten.
Wir wenden uns dem ersten Ergebnis der statistischen Untersuchung zu.
Überraschend erscheint, dass zunächst aus dem Material eine positive Haltung gegenüber der Kirche in über 90% der Gesamtheit der befragten Jugend
festzustellen ist. Allerdings wird sie später dann in verschiedener Weise eingeschränkt, teilweise sogar g a m erheblich. Es ist nicht so, dass man sie in Bausch
und Bogen bejaht, aber man lehnt sie auch nicht in Bausch und Bogen einfach
ab. was heute doch öfters zu hören ist. 93% haben am Religionsunterricht teilgenommen, 9 3 e b e n f a l l s sind konfirmiert. Zwar spielt bei diesen beiden Zahlen
stark die Tradition und die Bestimmung durch das Elternhaus herein, aber wesentlich ist, dass die Jugendlichen selber sich positiv in diese Tradition hineinstellen und sie ihrerseits bejahen, auch das allerdings nur wieder in ganz allgemeiner Weise. Von der Jugendlichen werden 93% selber später ihre Kinder taufen lassen, und nur 8?* stellen sich grundsätzlich gegen eine kirchliche Trauung,
womit 92% der Trauung eine, wenn auch sehr verschieden geartete, positive Bedeutung beimessen.
Angesichts der Klage, dass die Jugend der Kirche mehr und mehr verloren
gehe, weil sie nicht in den Gottesdiensten zu sehen sei, und das religiöse Leben
und die Aktivität der Gemeinde nur von den Älteren getragen werde, muss man
doch erstaunen über die grosse Offenheit und Bereitschaft, die in ganz allgemeiner Form der Religion entgegengebracht wird. Woelber interpretiert diese maximale Zustimmung'\so, dass die Kirche auch im Bewusstsein der Jugend noch eine
der vorgegebenen Gemeinschaftsformen wie Familie, Volk, Klasse ist, zu der man
zunächst dazu gehört. In dem Ausmass, wie diese Zustimmung differenziert und
konkretisiert wird in Richtung auf Einzelheiten des Glaubens, sinken die Zahlen.
In religiösen Dingen ist es anders als etwa bei einer Besucherorganisation des
Theaters. Man kann dieses bis in einzelne Thesen über dasselbe hinein bejahen,
ohne schon gleich einer solchen Organisation anzugehören. „Religiös gehoert
man zunächst an, erst dann kommt es zu ganz allgemeinen Bejahungen".
Aui der Plattform dieser ganz allgemeinen Zustimmung kommt es nun zu
gewissen Einschränkungen. Diese werden nach zwei Richtungen hin deutlich:
Einmal, sobald das Moment der persönlichen Stellungnahme hineingezogen wird,
dass heisst eine eigene Entscheidung gefordert wird. Fragen in dieser Richtung
lauteten etwa: Wenn es in Ihrer Schulzeit auf Ihren eigenen Entschluss angekommen wäre, hätten Sie dann Interesse am Religionsunterricht gehabt? Wenn
ich Ihnen die Frage stelle, ob Sie ,an Gott glauben, hätten Sie etwas dagegen?
Noch 83% beantworten diese Fragen positiv. Sie hätten Interesse am Unterricht
und haben nichts gegen die Frage nach dem Glauben an iGott. Die andere Seite
der Einschränkung erscheint, wenn die Frage weltanschaulich, ideologisch oder
dogmatisch gefärbt ist. Etwa: Ist die Bibel Gottes Wort? Muss man glauben,
35
dass Jesus Christus Gottes Sohn ist? Glauben Sie an einen persönlichen Gott,
himmlischen Vater? J e nach dem Grad der dogmatischen H e r a u s f o r d e r u n g in
den einzelnen F r a g e n geht die Zustimmung weiter zurück. Das Band erstreckt
hier von 76 bis 51% herunter. Bei der Kombinierung der dogmatischen F r a g e mit
der Forderung der persönlichen Entscheidung innerhalb derselben (etwa: Glauben. Sie, dass der Verlauf Ihres Lebens von einer göttlichen F ü h r u n g oder von
Naturgesetzmässigkeiten bestimmt ist? Wie ist I h r e Überzeugung, f ü h r e n m e h r e r e Religionen zu Gott oder nur das C h r i s t e n t u m ? E r f ü l l t nach I h r e r Ansicht
die Kirche ihre A u f g a b e unbedingt und im ganzen?) liegt die Zustimmung auf
einem Band von 49 bis 39%. Alle F r a g e n gingen hier auf die persönliche Meinung aus. Eine u n t e r s t e Grenze der Z u s t i m m u n g wird erreicht bei. Aussagen, die
streng von der kirchlichen Dogmatik geprägt sind und die kirchliche Terminologie benutzen, zum Beispiel: Wichtig beim Weihnachtsfest ist die Aussage: J e sus Christus ist f ü r uns geboren, oder: T a u f e bedeutet E r l ö s u n g von E r b s ü n d e
und ist von Gott eingesetzt. Hier bewegen sich die bejahenden Antworten in statistisch fast nicht mehr deutbaren Mengen, u n g e f ä h r zwischen 3 und 6%.
Wenn wir diese Bänder der verschiedenen Zustimmungen überschauen, muss
man dieses Ergebnis nach zwei Seiten hin beurteilen. E i n m a l m u s s festgestellt
werden, dass ein starker Abbau der Verbundenheit mit der Kirche zu beobachten ist. Was allen Verantwortlichen, aber auch allen, die mit Anteilnahme und
wachem Beobachten in unserer Zeit leben, Unruhe macht,, ist dieser Auszug aus
der Kirche, der besonders, aber nicht allein, von der Jugend vorgenommen wird.
„Die Abhängigkeit der Zustimmung zu Glaube, Religion, Kirche von der Intensität des auf die eigene Entscheidung Gestellt-seins" nennt Woelber ein Grundgeset2 unserer kirchlichen Situation. „Die Gewissheit nimmt, in dem Masse ab, wie
der Zusammenhang Religion — Kirche aus der sozialen Geborgenheit auswandert und aui eigene Entscheidung gestellt ist. Sie n i m m t auch in dem Masse ab,
wie man zu einer bekenntnismässigen, dogmatischen,
intellektuellen Aussage
vorschreitet," 'S. 38) Weil Kirche, Glaube, Religion in s t a r k e m Masse sozial verankert sind, deshalb haben sie Anteil an dem Umbruch, der im sozialen Bereich
heute stattfindet, indem die Ungewissheit und das allgemeine verschwommene
Meinen wächst, wie die durch Wisäen und Verarbeitung fundierte Klarheit zusammen mit der durch das persönliche E n g a g e m e n t und mutige Entschiedenheit
ausgezeichneten Glaubenshaltung abnimmt. Dieser Eindruck t r i f f t sicher auch
aui viele andere Lebensgebiete zu, oft umschrieben mit der Begeisterungslosigkeit und Sachlichkeit moderner Jugend, die keine Ideale mehr anerkennt. Man
wird bei diesen zunächst erschreckenden Feststellungen die Verwurzelung im Gesamtbereich des gesellschaftlichen Lebens sehen müssen, um nicht vorschnell zu
verurteilen, Man hat es nicht nur mit Nachkriegserscheinungen in Deutschland
zu tun,, sondern mit einer viel tiefer greifenden Entwicklung. Man würde zu ä h n lichen Ergebnissen unter der deutschstämmigen Jugend in Chile, vorzugsweise in
den grösseren Städten, kommen, was auf einen ähnlichen Zerfallsprozess der ehemals tragenden sozialen K r ä f t e schliessen lässt. Kirche und deutsches Volkstum
waren zu eng liiert, als dass nun nicht auf religiösem Gebiet dieselben Zeichen der
Zeit zu sehen sein sollten wie auf kulturellem: Unsicherheit, verschwommene allgemeine Vorstellungen, in gewissem Sinn Resignation.
36
Nach der anderen Seite hin wird dies Ergebnis positiv zu beurteilen sein. Es
zeigt, dass die Bereitschaft und Offenheit dem religiösen Leben gegenüber viel
grösser ist als die Zahl der nach aussen in Erscheinung tretenden Kirchenchristen.
Die Einflussphäre der kirchlichen Verkündigung reicht offenbar weiter als die
aktiven Gemeindekerne. Die Zahl der Gottesdienstbesucher an gewöhnlichen
Sonntagen und die Zahlen der Mitarbeiter in den Cemeindekreisen werden nicht
gleichzusetzen sein mit dem Umfang der Kirche und dem Einflusstoereich der Religion. Die Grenzen zwischen Kirche und Welt sind nicht dieselben wie zwischen
Glauben und Unglauben oder Christen und Atheisten. Dieser relativ kleinen, etwa
um 10% herumliegenden, Zahl der aktiven Gemeindeglieder steht nicht eine grosse Masse gleichgültiger Atheisten und Glaubensloser gegenüber, sondern eine
grosse Gruppe von Menscher., die in sich wieder sehr verschieden gegliedert erscheint, und die sich selber als religiös bezeichnet und von der Kirche einiges erwartet, Das ist wichtig, weil vom Standpunkt der Kerngemeinde aus diese grosse
Gruppe schnell abgeschrieben wird und als „verloren" bezeichnet wird. Sie sind
zwar aus der Kirche im Auszug begriffen, aber deshalb nicht Atheisten geworden. So urteilt Woelber, dass man die „zahlenmässig grosse Spannung zwischen
dem kirchlichen Kern und den kirchlichen Steuerzahlern bzw. denjenigen, die die
kirchlichen Bedingungshandlungen (wie Taufe, Konfirmation,
Religionsunterricht, Beerdigung) übernehmen" nicht interpretieren könne in Richtung etwa des
Gedankens, dass sie vergessen hätten, ihren Austritt zu erklären, sondern
dass sie weiterhin ein religiöses Interesse hätten, das durch die Steuern oder die
Teilnahme an den Handlungen der Kirche noch im weitesten Sinne sich bekundet.
Es hat sich eine Zwischenkirche gebildet. „Beinahe die Hälfte unseres Volkes rechnet sich zu dieser Zwischenkirche." (S. 112) Diese Entdeckung ist überaus bedeutsam und hat dem Buch seinen Namen gegeben. Die „Religion ohne Entscheidung" ist die Religion dieser „institutionsunfähigen, vom Menschlichen her gesehen sicher tragischen Zwischenkirche". Im Spiegel der Jugend, den sie immer
wieder neu ihrer eigenen Zeit vorhält, erscheint dieses Phänomen offenbar deutlicher als anderswo.
Besonders betont werden soll noch einmal, dass diese Gruppe sich nicht nur
von der sogenannten Kerngemeinde, den Kirchentreuen, abhebt, sondern ebenso
deutlich sich von der Gruppe der sogenannten Traditionstreuen
unterscheidet.
Letztere nehmen an den Handlungen der Kirche wie Taufe, Konfirmation, Weihnachtsfest, Beerdigung aus reinem Sozialprestige teil. „Man tut, was alle t u n "
(S. 105), ohne eine weitere Reflexion darüber anzustellen. Die Zwischenkirche
geht über die rein passive oder nur aus dem Sozialprestige begruendete Haltung
hinaus, und findet sich beunruhigt und i n ' F r a g e gestellt, ohne die rechte
-m
des Verhaltens und Praktizierens zu finden. Zu ihnen sind auf Grund de
stischen Untersuchung ein Drittel bis zwei Fünftel der Gesamtheit zu •
Sie bekunden echte religiöse Motive, die nicht mit dem Sozialprestige
setzt werden können.
Der weiteren Analyse und Sichtbarmachung dieser Erscheinung d'
in Einzelheiten vorstossende Untersuchung Hans-Otto Woelber's, unr
ihr auf diesem Weg noch in einigen Punkten folgen.
In den Antworten haben 56% bekannt, an einen persönlichen
ben. Aul die weitere Frage des Interviewers: Können Sie mir sagen, was Sie dabei
für Vorstellungen haben? antwortet die Hälfte: Das weiss ich nicht, ich kann
mich da nicht ausdrücken. Woelber interpretiert: „Man muss vermuten, dass von
der Gesamtheit weniger als ein Zehntel wirklich eine persönliche Gottesvorstellung hat." (S. 44) Selbst in den Jugendgruppen der evangelischen Jugend Deutschlands fehlen, wie aus einer Zusatzuntersuchung hervongeht, die Bilder einer persönlichen Frömmigkeit, einer echten, der Jugend ganz gewiss
zugebilligten
schwärmerischen Heilandsliebe und Ergriffenheit. Es fehlt fast ganz das Gegenüber des grossen DU. Ob deshalb soviel Schwärmerei f ü r Ersatzleitbilder, etwa
Filmgrössen oder Schlagersänger, zu erleben ist? Aber auch das zeugt davon,
dass hier ein grosses Defizit empfunden wird. Diese Schwärmerei ist deswegen
ein Ersatz, weil sie im allgemeinen rein „platonisch" bleiben muss und nie zu
einer echten Begegnung führt, die menschlich ¡prägt und formt. Sie bleibt in einer Scheinwelt und verhaftet in dieser. Sie ist nicht zu verurteilen, weil die „Objekte" einer solchen Verehrung nicht würdig wären, denn das kann die Jugend
nicht erfassen. Es gibt ja auch durchaus würdige, charakterlich geformte Leitbilder, etwa einen Sportler oder persönlich lauteren Kriegshelden. Aber ihr Ersatzcharakter wird darin offenbar,' dass sie nicht einzelne Personen sind, sondern
Typen; sie nivellieren gerade das Persönliche, Einmalige dieses Menschen, und
stellen eine Idee oder einen Typus heraus. Diese Schwärmerei f ü h r t nicht hin zur
Begegnung und in dieser zur persönlichen Erfahrung, die erst wirklich reifen
lässt. Sie ist deshalb zu verurteilen, weil sie in der Typisierung eine künstliche
Welt mit falschen Masstäben aufbaut, die untüchtig macht zum Leben und Bestehen dieser unserer realen Welt.
In der Tiefe hängt es mit dem Fehlen des «grossen Gegenübers zusammen.
Auf geheimnisvolle Weise wird hier eine biblische Grundwahrheit bestätigt. Der
Mensch, der das DU Gottes verliert, findet .auch das DU zum Mitmenschen nicht
mehr in der Fülle und muss sich mit einem Scheingegenüber begnügen.
Auf religiösem Gebiet ist eine besondere Ersatzleistung bei dem Ausbleiben
der persönlichen Frömmigkeit zu beobachten. E s besteht ein erhöhtes Bedürfnis
nach sachlicher Information. Für viele besteht das Interesse am Religionsunterricht in dieser Möglichkeit, sich sachlich zu informieren über Religionen, ethische
Probleme, ganz allgemein über die Position der Kirche. Auch darüber muss
man heute etwas wissen, so urteilt man. Dieses lebhafte Interesse ist verbünde«
mit persönlicher Distanz. Der Religionsunterricht kann „interessant" sein, aber
wird kaum als „packend", im Innersten „ergreifend" empfunden. Religion bedeutete immer Persönlichstes und Intimstes des Menschen. Es scheint, dass heute
unter den Händen, die dieses Thema aufgreifen, gleichsam eine Verwandlung desselben in sachliche und nüchterne Distanz hinein vor sich geht. Religiös interessierte und diskutierende Jugend braucht heute nicht f r o m m zu sein. Bei aller
Sachlichkeit ist das personale Moment der Gottesbeziehung verloren gegangen.
„An die Stelle der Religion als Begegnung mit dem lebendigen Gott ist die Religion als Eventual-Ideologie getreten." (S. 50.)
Dies.es Ergebnis ist weithin auch zutreffend auf die Situation der Jugend in
Chile (immer die Jugend deutscher Abstammung in Chile, die durch Taufe, Unterricht und Konfirmation als die Jugend der lutherischen Kirche anzusprechen
38
ist). Das Thema, das am h ä u f i g s t e n in Diskussionen a u f t a u c h t , und auf das hin
andere Themen z u r ü c k z u f ü h r e n sind. W a r u m b e h a u p t e t das Christentum, allein
den Weg zu Gott zu wissen? W a r u m können nicht auch andere Religionen diesen
Weg gut zeigen? Man m ü s s t e andere Religionen k e n n e n lernen. E s besteht eine
entschiedene Weigerung, sich gleich in die Entscheidung r u f e n zu lassen, sich fest
engagieren zu lassen. Die Diskussionen sind solange gut, als sie nicht zu einem
Zeugnis oder Bekenntnis eines einzelnen f ü h r e n . Eine G r u n d e r f a h r u n g lehrt, dass
sie regelmässig abbrechen, und das offene Interesse erlischt, sobald einer zu einem solchen Zeugnis voranschreitet und bekennt, was e r persönlich glaubt. „Man
findet das Zeugnis geradezu als Beendigung der beabsichtigten religiösen Kommunikation." (S. 53.)
Das bedeutet nicht einfach, dass die Jugend skeptisch sei. Denn auch die der
Skepsis entsprechende Lebenshaltung, die klare Absage a n positive Glaubenshaltungen fehlt. Es ist nicht Skepsis, sondern der Verzicht ü b e r h a u p t einer klaren
Formulierung f ü r oder gegen das Christentum und die Religion mit festen Gründen, es ist ein Rückzug aus der intellektuellen und ideologischen Aufarbeitung,
die zu positiven oder negativen Resultaten f ü h r e n kann, der die religiöse Situation dieser Zwischenkirche kennzeichnet. Es fehlt die S e l b s t f o r m u n g zu einem
klaren geistigen Standpunkt, es bleibt E r w a r t u n g , Offenheit, vielleicht sogar
Sehnsucht gegenüber der christlichen Botschaft und der Kirche als deren Verkündigerin. Man vermisst die Dränger und Sucher, oder die leidenschaftlichen
Anklagen gegen die Kirche. Man t r i f f t oft n u r das Achselzucken, das sowohl
Nicht-Wissen als auch Nicht-Können bedeutet.
Auch f ü r die kirchliche Verkündigung hat das eine Reihe von Konsequenzen.
„Nicht selten wird man den Eindruck nicht los, als wolle die Kirche auf der Bühne geschichtlicher Wirklichkeit voreilig Zustimmung f o r d e r n . Sie steht in der
Versuchung, die Menschen auf sich allein zu verpflichten und die Begegnung mit
Gott durch Kirchenfleiss zu ersetzen." (S. 62.)
Ein weiteres Ergebnis der Untersuchung u n t e r m a u e r t den Eindruck und das
Bild, das von der Zwischenkirche gewonnen wurde, und f ü g t eine weitere Charakteristik hinzu. Befragt nach religiösen Personen, die der Jugendliche persönlich kannte, besonders auch nach P f a r r e r n , antworteten erstaunlich viele positiv.
82% kannten P f a r r e r , und 42% aller Befragten kannten religiöse Menschen. Das
scheint zunächst ein überaus gutes Zeugnis, dass die H ä l f t e der Jugend um sich
herum religiöse Menschen kennt und erlebt. Interessant und ¡bezeichnend ist die
ins Einzelne gehende Beschreibung eines religiösen oder f r o m m e n Menschen. Allein 67% forderten mitmenschliche und ethische Kennzeichen, wie Gesinnung,
Charakter, anständige, s a u b e r e Lebensführung, Rücksichtnahme, Toleranz. N u r
18% forderten speziell christliche oder kirchliche Kennzeichen der Frömmigkeit,
wie regelmässigen Gottesdienstbesuch, Gebet, Verhältnis z u , den Sakramenten.
Bei den P f a r r e r n und J u g e n d f ü h r e r n liegen die Verhältnisse ganz ähnlich. 50%
fordert vom idealen P f a r r e r , dass er hilfsbereit, liebevoll, menschlich, unparteiisch, tolerant und bescheiden sei. Von den 23%, die einen P f a r r e r kritisierten, hatten 15% Versagen im menschlichen Verhalten auszusetzen, und gaben an, dass er
eingebildet, überheblich oder zu s t r e n g gewesen sei. D a g e g e n kritisieren die P r e digt eines P f a r r e r s n u r 1%; umgekehrt, vom idealen P f a r r e r fordern n u r 8%, dass
39
er ein guter Prediger sei. Hier zeigt sich eine eindeutige Richtung auf das Ethische, die Religion wird weithin mit Ethik gleichgesetzt. Das ist von der Bibel und
der christlichen Verkündigung her gesehen eine starke Verkürzung des Glaubens. Der gute Christ ist der moralisch einwandfreie und mitmenschlich richtig
funktionierende Mensch.
Diese Überzeugung wird von der Jugend der hiesigen Kirche mehr oder weniger bestätigt werden. Wirkt hier das idealistische Erbe nach, das in der Geistesgeschichte unseres Volkes ein so festes Bündnis mit dem Christentum eingegangen war? Wird nun ein flaches Verständnis von Idealismus verwechselt mit dem
ganz anders gearteten Glauben des Christen? In vielen Gesprächen zeigt sich
immer wieder die Gleichsetzung, ein gläubiger Mensch ist idealistisch. Das ist
aber eine Verfälschung dessen, was die Bibel Glauben nennt. Da geht es doch
gerade um das Annehmen und Realisieren der Rettung eines Lebens durch Gott,
das nicht gut ist und nicht harmonisch in der Gemeinschaft der Mitmenschen
1
steht
Andererseits muss man feststellen, wie an diesem Punkte ein Widerspruch
auftaucht. Die Kirche soll Informationen vermitteln, die in nüchterner Distanz
zur Kenntnis genommen werden, ohne dass der einzelne daraas Folgerungen f ü r
sein Leben zu ziehen gewillt ist. Wenn aber nach Beispielen aus dem Leben gef r a g t wird, sind es nicht Menschen, die diese Kenntnisse besitzen, sondern es wird
auf solche hingewiesen, die durch den personalen Vollzug der Religion im täglichen Leben auffallen. Besonders bei der Person des P f a r r e r s ist das auffällig,
der ja logischerweise als der Spezialist f ü r die religiöse Information anzusehen
wäre. Gerade hier f r a g t man nicht nach seinen detallierten Kenntnissen, die er
in der Religion und der Dogmatik hat, sondern m a n möchte sehen und erleben,
wie er als einzelner den Glauben in seinem persönlichen Leben vollzieht. „Die
Wahrheit kommt über die Person." (S. 72) Sie lässt sich nicht vom persönlichen
Leben ablösen und versachlichen, oder in Dogmen pressen. Sie kann nur von innen her im Vollzug erfahren, nicht von aussen im intellektuellen Beweis demonstriert werden. Das beleuchtet von hinten her die ganze Situation der Unentschiedenheit, Unklarheit und Unsicherheit, obwohl auf das gesteigerte Informationsbedürfnis der Jugend von der Kirche auch weithin mit umfangreicher Mitteilung
geantwortet wird.
Wieviel Bücher, wieviel Unterricht, wieviel Darstellung der christlichen Wahrheit! Oft fragt man sich ängstlich, warum so wenig „Erfolg" sichtbar wird. Gott
aber braucht Figuren, die seine Botschaft in ihrem Leben darstellen, nicht nur
Theorien darüber verbreiten. E s wird wohl alles auf das Leben der Christen und
wenig auf die Worte ankommen. Auf geheimnisvolle Weise bestätigt hier der
statistische Befund eine theologisch längst klare Erkenntnis. Gerade in der logisch inkonsequenten Haltung offenbart hier das Leben f a s t wie in einem Schrei
die Sehnsucht danach, dass Gottes Botschaft in Gestalten von Fleisch und Blut
mitten in unserem Alltag sichtbar werde. Das so distanziert und sachlich geführte Gespräch über religiöse „Probleme" ist die nach aussen gezeigte Fassade, die
diese Not verdeckt. Aber Gottes Botschaft soll g a r nicht in erster Linie überzeugen, sie soll nur die K r a f t zeigen und mitteilen, ein Leben zu gestalten und zu
heilen. So erweist sich alle Kritik an der Kirche als Kritik an den Christen, an
40
den einzelnen Gliedern derselben. Verkündigung geschieht durch personale Begegnung. Sie wird nicht im System der Lehren als richtig empfunden, sondern
im Wagnis der eizenlen Entscheidungen, die auf die Wahrheit hin g e t r o f f e n und
im Leben vollzogen werden.
Der Ruf nach der personalen Begegnung ist aber in erster Linie nicht der
Ruf nach den Vertretern der Kirche, sondern nach den Eltern. Aus vielen Antworten geht hervor, dass der Ort intensiver Begegnung und religiöser K o m m u n i k a tion das Elternhaus ist. Der entscheidende Raum, wo religiöse Grundentscheidungen fallen oder v e r s ä u m t werden, ist die Familie. Die Gestalt der Mutter spielt
nach einer grossen Zahl der Antworten eine besondere Rolle. Hilfe in schweren
Erlebnissen hat in den meisten Fällen die Familie, besonders die M u t t e r gegeben.
Hier kann etwas von der eigenen Überzeugung in echter Weise demonstriert werden. Umgekehrt, legt das Material der Untersuchung die F r a g e nahe, ob nicht
in steigendem Masse die Familie versagt, so dass notwendige Entscheidungen
vielleicht f ü r immer nicht gefällt werden, indem sie die religiöse F o r m u n g der
Kinder mehr und mehr der Schule und dem Konfirmandenunterricht überlässt.
Dieser aber ist mit dem „Zwang" des Unterrichtet-Werdens belastet, so dass die
echte Freiheit einer personalen Begegnung oft nicht möglich ist. Die religiöse
Formung wird aber so aus einem Werterlebnis zu einer Wissensvermittlung verfälscht, Woelber folgert: „Die Familie ist von primaerer Bedeutung f ü r die christliche Erziehung." (S. 140) W a s sich hier als höchst notwendig erweist, sind
Menschen, die es wagen, den Glauben als eine Realität in ihr Leben, konkret in
ihr H a u s hineinzunehmen. E s geht dabei nicht u m alte Bräuche oder e r s t a r r t e
Sitten, sondern um das persönliche Betroffens^in. Welche Lösungen die Eltern
in den F r a g e n des Lebens im Hinhören auf die S t i m m e Christi finden, das kann
nicht automatisch in gleicher Weise f ü r die Kinder gelten. Aber der E r n s t und
die Echtheit des Ringens um die Lösungen als Ausdruck ihres Glaubens werden
für .die Kinder entscheidende religiöse Erlebnisse darstellen, die wesentliche Bedeutung f ü r ihr späteres Leben gewinnen. Es erweist sich als ein I r r t u m , Kinder
ohne religiöse Erziehung aufwachsen zu lassen, damit sie als Erwachsene selber
entscheiden, was sie glauben, und was nicht. Dann sind die Entscheidungen längst
gefallen. Das f ü h r t auf eine letzte Beobachtung. Der Rückzug aus der Bereitschaft
zur Entscheidung und zur intellektuellen Selbstformung kann nach den Ergebnissen der Untersuchung nicht nur als der Grund der Bildung der Zwischenkirche verstanden werden, die nun ihrerseits den Auszug aus der Geschlossenheit
der Gemeinde vollzieht, sondern auch umgekehrt. Wir sahen schon, dass wesentliche Bedeutung f ü r den persönlichen Glauben des einzelnen die F o r m u n g durch
die Familie und das Beispiel religiöser Menschen hat. Das legt die F r a g e nahe,
ob nicht der Auszug ,aus der G e m e i n s c h a f t u n f ä h i g m a c h t zur persönlichen E n t scheidung und intellektuellen
Selbstformung. Offenbar geht beides Hand in
Sand. Die Kirche hat sehr s t a r k die Religion des einzelnen und seinen persönlichen Glauben betont und viel weniger die Gemeinschaft und ihre Gestaltung; nun
{erfällt die Gemeinschaft, und der ungeborgene Mensch verliert die Fähigkeit der
Orientierung und die K r a f t zu persönlichen Bekenntnissen. Aber die Kirche „vergeht sich nicht als S u m m e der einzelnen mit lauter individuellen Entscheidun!«n. Sie versteht das Ereignis des Geistes als Gliedschaft. Deshalb tragen die E n t 41
Scheidungen die Communio, sie werden aber auch durch diese getragen... Religion
ohne Entscheidung bedeutet im Grunde also Religion ohne Gemeinschaft". S. 60.)
Zusammenfassend will die Untersuchung deutlich machen, dass auf dem geschichtlichen Weg unserer Kirche sich eine Situation ergeben hat, die wohl als
ein Übergang zu erklären ist: Die Bildung einer Zwischenkirche. Sie kann wohl
kaum als Ergebnis und als Dauerzustand angesehen werden. E s ist offen, nach
welcher Richtung hin dieser Übergang erfolgen wird, ob er ein endgültiger Auszug eines grossen Teils unseres Volkes aus der Kirche bedeuten wird oder ein
Übergang in völlig neue kirchliche Formen, nachdem die alten zusammen mit der
Gestalt des bürgerlichen Lebens mehr und mehr zusammenbrechen. Aus dem
Geschichtsverständnis des Neuen Testamentes heraus, bedeutet es sicher eine Anfrage Gottes an uns, wie wir auf diese Herausforderung antworten wollen. Sicher
werden wir nicht alte Formen k r a m p f h a f t festhalten können, sondern ernsthaft
zu neuen vorstossen müssen. Im Mittelpunkt kann nicht das Erbe einer bestimmten Kultur- und Geisteswelt stehen, sondern nur das Zeugnis von der Barmherzigkeit Gottes in Jesus Christus. Zeugnis heisst persönlich immer neu gelebter
Glaube inmitten unserer Probleme. In dieses Wagnis der Entscheidung sind wir
gerufen. So kann aus der verschwommenen, unprofilierten und lustlosen Meinung
und der passiven Hinnahme ererbter Religion eine neue Hoffnung und ein klares
Bekenntnis werden, so dass wir unseres Glaubens neu f r o h werden.
42
WERNER HONOLD — Valdivia
ER SCHAUT DIE ERDE AN, SO BEBT SIE
Das Erdbeben in Chile 1960
Theologische Gedanken
zu
einem geologischen Ereignis
Wäre das Erdbeben in Chile vom Mai 1960 nur e i n e m Katastrophenherd
entsprungen, hätten sich die Erschütterungen nur in e i n e m Ausbruch auf nur
e i n Epizentrum an der Erdoberfläche konzentriert, könnte man nur von e i n e m
Erdbeben oder auch nur von E r d beben sprechen, dann wäre es kaum gerechtfertigt das Geschehen vom 21. und 22. Mai in Südchile als ein Ereignis zu bezeichnen und ihm so eine Bedeutung beizumessen, die es über ähnliche Geschehen —
etwa das Erdbeben von Agadir (Marokko) im April 1960 — hinaushebt.
Auch wenn man die 358 mehr oder weniger starken Erdstösse von Mai 1960
bis Mai 1961 als kleine Nachbeben ausser acht lässt, so standen dort am Anfang
gleich schwere Beben, die schon, durch ihr Ausmass und ihre Auswirkung von sich
reden machten. Man denke nur a n die — wohl bleibende — Überflutung von
kaum weniger als 50.000 Hektar Weideland und an die grosse Überschwemmung
in und um Valdivia am 25. Juli, ganz zu schweigen von den ungezählten Zerstörungen in den vielen Städten und Dörfern.
Dazu kam noch die f ü r ein Erdbeben riesenhafte Ausdehnung von rund 800
km, die von der Industriestadt Concepción im Norden bis zur Insel Chiloé im
Süden reicht? und gerade das Gebiet umfasste, das im letzten Jahrhundert von
Deutschen besiedelt, f r u c h t b a r gemacht und industriell erschlossen worden ist.
Und schliesslich folgte dem 2. Erdbeben, das über die südlichen Teile des langen Katastrophenabschnittes hereinbrach, noch ein Seebeben, das die pazifische
Küste das Schicksal des Roten Meeres erleben liess, wie es das 2. Buch Mose beim
Auszug Israels aus Ägypten schildert; nur dass die zurückflutenden Meereswellen nicht die Streitmacht der Ägypter, sondern zahlreiche Fischerorte, Badeorte,
ja sogar die niedrig gelegenen Teile einer kleinen Hafenstadt unter sich begruben
und wegspülten.
So kann man, ja so muss man von einem geologischen Ereignis sprechen,
im Sinn eines besonders aussergewöhnlichen, in mancher Hinsicht wohl sogar
einmaligen Geschehens; denn — wie manche Geologen sagen — so etwas, in dieser Art und Ausdehnung, hat es in historischer Zeit noch nicht gegeben.
43
Das ist Grund genug f ü r uns, um uns über dieses geologische Ereignis wenigstens einige theologische Gedanken zu machen, Grund genug, um uns zu f r a gen: Was sagt die Theologie, die Lehre von Gott, zu dieser schauerlichen Demonstration der Geologie, der Lehre von der Erde?
Das ist keine bloss akademische Frage, von Leuten gestellt, deren Interesse
sich auf eine gedankliche Klärung beschränkt, sondern eine F r a g e des Glaubens,
welche die Menschen bewegt, die damals und darnach, äusserlich und innerlich,
so erschüttert worden sind, dass sie meinen konnten, das Ende der Welt sei gekommen.
I.
Wohl alle Betroffenen werden sich ihre Gedanken gemacht haben, aber eben
i h r e Gedanken. Und dabei heisst es doch:
„Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine
Wege, spricht der Herr; sondern so viel der Himmel höher ist denn die Erde, so
sind auch meine Wege höher denn eure Wege und meine Gedanken denn eure Gedanken/' (Jes. 55, 8f)
Dass wirklich ein himmelweiter Unterschied zwischen unsren Gedanken und
seinen Gedanken ist, das zeigte sich am 21. und 22. Mai 1960 mit wünschenswerter Deutlichkeit.
Als in den Morgenstunden des 21. Mai die Stadt und Umgebung von Concepción durch das erste schwere Beben betroffen wurde, da reichten wohl die E r schütterungen — sehr spürbar — weit nach Süden, aber nicht so weit, dass die
Bewohner in ihrer Sicherheit erschüttert wurden. Den warnenden Stimmen erklärte man: Hier passiert nichts, hier sind wir sicher. So ging man ruhig schlafen.
Freilich dürfen wir uns auch ja gerade mitten in der Gefahr bei Gott geborgen wissen, so dass wir mit Ruhe und ohne Angst schlafen können, wie es der
Dichter des 4. Psalms konnte, der sagte: „Ich liege und schlafe ganz mit Frieden," „denn" (jetzt, geht es aber nicht weiter: mir wird schon nichts passieren,
sondern:) „ a l l e i n d u , Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne." (Ps. 4, 9). Wir
glaubten das wohl, in dem Sinn, dass wir es f ü r eine theoretische Wahrheit hielten, was dieser Bibelspruch sagt. Aber wir rechneten nicht mit seiner praktischen
Wirklichkeit.
Daher musste uns Gott korrigieren. Daher musste er unsere Selbstsicherheit
erschüttern und uns so zeigen, dass unsere Sicherheit nicht in uns, sondern in
ihm, allein in inm ruht.
II.
Was aber von uns Menschen, den Geschöpfen Gottes gilt, das gilt auch von
der Schöpfung. Die ganze ¡geschaffene Welt hat ihren Bestand und ihre Sicherheit allein ihrem Schöpfer zu verdanken. Der Kosmos, die geordnete, schöne Welt,
die Gott aus dem Chaos entstehen liess, muss von ihm erhalten werden, wenn
nicht wieder das Chaos über die Erde und die Welt hereinbrechen soll.
Die Wasser, die einst die ganze Erde bedeckten und dann — bei der Erschaf 44
fung der Welt — an bestimmten Orten, genannt Meere, gesammelt wurden (1. Mose 1, 9f), müssen von der Hand des grossen Meisters gehalten werden, damit sie
die 'Erde nicht wieder überfluten.
An Hiob richtet Gott die Frage:
„Wer hat das Meer mit Türen verschlossen... und setzte ihm Riegel und Türen und sprach: Bis hierher sollst du kommen und nicht weiter; hier sollen sich
legen deine stolzen Wellen?" (Hiob, 38, 8, lOf).
Die Antwort ist klar:
Gott, der Schöpfer aller Dinge ist es, der „dem Meer das Ziel setzte und den
Wassern, dass sie nicht überschreiten seinen Befehl."
Er ist es ja, der „den Grund der Erde legte." (Spr. 8, 29.)
Aber nicht nur das Meer und die Wasser, die gesamte Schöpfung steht unter
dem Befehl des grossen Schöpfers. Denn „Gott hat die Welt gemacht und alles
was darinnen ist." (Apostelg. 17, 24.)
Er iot es auch, „der die Berge festsetzt in seiner Kraft." (Ps. 65, 7.)
„In seiner Hand ist, was unten in der Erde ist; und die Höhen der Berge sind
auch sedn." (Ps. 95, 4.)
Wenn aber alles von Gott geschaffen worden ist und alles von ihm erhalten
wird, wenn also nicht n u r die Entstehung der Schöpfung, sondern auch ihr Bestand ausschliesslich in der Hand des Schöpfers liegt, dann kann er es mit der
Erhaltung seiner Schöpfung auch einmal anders halten, als er es gewöhnlich
tut, anders, als wir es — zu sehr schon — gewohnt sind.
Er hat es in der Hand. Wenn die Wassermassen nur deshalb nicht die Erde
überfluten, weil sie der Befehl Gottes daran hindert, dann hindert sie nichts mehr,
wenn er seinen Befehl einmal ändert. Wenn die Berge nur deshalb fest sind, weil
er sie fest gesetzt hat, w e r sollte sie dann noch festhalten und vor dem Einsturz
bewahren, wenn Gott es nicht mehr t u t ? Wenn Gott allein es in der Hand hat,
was aus dem Innern der Erde wird, seitdem er ihren Grund gelegt hat, dann wird
es grundlegend, wirklich von Grund auf anders, wenn seine Hand auch nur f ü r
kurze Zeit los lässt. Ja, es bedarf nicht einmal einer Handbewegung. Nicht einmal
den Finger rühren braucht der H e r r aller Herren. Ein Blick (genügt.
„E,r schaut die Erde an, so bebt sie." (iPs. 104, 32.)"
Dieses Wort hörte die Gemeinde in Valdivia, als sie sich am Morgen des 22.
Mai zum sonntäglichen'Gottesdienst versammelte.
Wir glaubten sie auch, diese Worte, aber wieder nur als theoretische Wahrheit, nicht als praktische, auch f ü r uns geltende Wirklichkeit. Einige Stunden
später war es dargi so weit.
Die Erde bebte, Berge stürzten ein und das Meer „wütete und wallte."
(Ps. 46, 4.)
III.
Wenn aber der Kosmos, die von Gott aus dem Chaos -geschaffene, und nicht
nur kosmisch, sondern fast kosmetisch schöne Welt, nur solange besteht, wie Gott
sie ¡bestehen lässt und wenn in dem Augenblick, wo er sie nicht mehr bestehen
lässt, wieder das Chaos entsteht, dann bedeutet das: Nicht nur der Kosmos, son45
dern auch das Chaos, nicht nur die Ordnung, sondern auch die Unordnung, nicht
nur das Glüok, sondern auch das Unglück, nicht nur die Wendungen zum Guten,
sondern auch die Wendungen zum Schlechten, ja auch die Katastrophen, die „Umwendungen" kommen von Gott.
„Es kommt alles von Gott, Glück und Unglüick." (Sirach 11, 14.)
„Ist auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht t u t ? " (Am. 3, 6.)
Es wäre daher — von der Bibel her gesehen — falsch, würde man das Erdbeben als eine Naturkatastrophe bezeichnen, in dem Sinn, dass die N a t u r der Urheber dieser „Umwendung" (wie Katastrophe wörtlich heisst) wäre.
Als in jenen schrecklichen Augenblicken von all dem, was sonst fest war,
nichts mehr fest war und man buchstäblich den Boden unter den Füssen verlor,
da war der am Werk, der sich gerade in dieser sog. Katastrophe als der unumschränkte Herr der Natur, als der erwiesen hat, der die Natur gemacht hat und
deshalb mit ihr machen kann, was er will.
Nicht die Natur und ihre Zerstörungen gilt es daher zu fürchten, sondern
den, „der auf Erden solch Zerstören anrichtet." (Ps. 46, 9.)
Und wenn nicht nur die Erde, sondern auch das Meer in Bewegung geriet,
sollten wir nicht nur nach den Bewegungen fragen, sondern vielmehr nach dem,
der sie verursacht hat und dem die Natur gehorchen muss, ob sie will oder nicht.
„Was ist das f ü r ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind?" (Mt.
8, 27.) Es ist der, der auch mit uns machen kann, was er will, ohne dass wir ihn
daran hindern können. Oder könnte ihn jemand daran hindern, das zunichte zu
machen, was er gemacht hat und sei es auch nur zu einem winzigen Bruchstück
und nur f ü r einen Bruchteil an Zeit? Oder wer wollte ihn deshalb zur Rede stellen, in der Meinung, Gott müsste sich vor uns verantworten? Wir sind doch Ton
in des Töpfers Hand. (Jes. 64, 7.) „Spricht auch der Ton zu seinem Töpfer: Was
machst du?" (Jes. 45, 9.)
IV.
Wenn wir aber zu Gott in einem derartigen Abhängigkeitsverhältnis stehen,
dann hängt f ü r uns alles vom Verhältnis Gottes zu uns ab. Wenn er uns — wie
der Töpfer seinen Ton — in der Hand hat und mit uns machen kann, was er will,
dann ist die entscheidende Frage: Was will er mit uns machen?
Wenn zwischen seinen Gedanken und unseren Gedanken ein so himmelweiter Unterschied ist, wie wir es in ersten Abschnitt gehört haben, dann zählen
nicht unsere Gedanken über Gott, sondern nur seine Gedanken über uns. W a s er
f ü r Gedanken hat, was er — nicht irgend ein Schicksal oder eine höhere Macht —
der Herr mit uns vorhat, wie er zu uns steht, das sind die Fragen, um die es geht.
Wir könnten von uns aus nichts dazu sagen, wenn Gott nichts von sich aus
sagen würde. Aber das ist nun gerade das, was man Offenbarung nennt, dass Gott
offen dargelegt und klar gesagt hat, wie er zu uns steht, was er mit uns vorhat,
wie er über uns denkt.
Wir Menschen brauchen gar nicht so viel Worte über Gott zu machen, denn
wir haben das Wort Gottes. Wir brauchen nicht Gedanken, sondern nur sein Wort
46
zu lesen, wenn wir wissen wollen, was seine Gedanken über uns sind. Dann lesen
wir:
„Ich weiss wohl, was ich f ü r Gedanken über euch habe, spricht der H e r r :
Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, des ihr
wartet." (Jer. 29, 11.)
Nach dem, was geschehen ist, klingt das wie eine Zumutung. Aber es klingt
nur so. Wohl war das, w a s wir am Tage des Schreckens
und an den vielen
schrecklichen Tagen darnach erlebt haben, nicht gerade das, was wir erwartet
hatten. Und doch w a r e n es Gedanken des Friedens und nicht des Leides, die Gott
dazu bewogen haben, uns derart durcheinander zu rütteln. Gerade der richtende
Gott, der uns dabei begegnet ist, will uns mit seinem Gericht ja nicht zugrunde
richten, sondern aufrichten. Wie schon das Volk Israel, so fasst Gott auch das
Christenvolk manchmal hart an, „dass er's zurichte und stärke mit Gericht"
(Jes. 9, 6.)
Wenn Gott Gericht über uns hält, dann will er uns davon abhalten, dass wir
auf Abwege geraten und dabei den Weg verfehlen, der am ewigen Leben vorbei
zum ewigen Tod f ü h r t . E r will, dass es das Ende mit uns nimmt, das er uns bereitet hat. Und das Leid, in das er uns stürzt, soll dazu dienen, dass auch wir
einmal zu denen gehören werden, von denen die Offenbarung sagt: „Er selbst,
Gott, wird mit ihnen sein; und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen,
und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird
mehr sein." iCOffbg. 21, 3f.)
Seine Macht und K r a f t hat uns Gott nur deshalb so deutlich gezeigt, damit
wir es nicht bloss theoretisch wissen, sondern auch praktisch erfahren: „Mit unsrer Macht ist nichts getan." (M. Luter.) Was er gemacht hat, hat er nur gemacht,
damit wir endlich merken: „Er hat uns gemacht und nicht wir selbst." (Ps. 100,
3.) Und seine K r a f t hat er uns nur deshalb so deutlich fühlen lassen, damit wir
mit dem Glauben an die eigene Kraft endlich aufhören und auch als Gemein-'
schaft einsehen: „Der Herr ist's, der die Kräfte gibt." (5. Mose 8, 18.) Das „Vater
unser" haben wir zwar schon immer gebetet und dabei gesagt: D e i n ist das
Reich und die K r a f t , aber einst meinten wir, sagen zu können, wie es in einer
alten Vereinsfestschrift heisst: Was wir sind, sind wir durch uns selbst geworden.
Aus eigener Kraft, so können wir stolz über unsere Häuser, Fabriken und Kon J
tore schreiben.
Jetzt steht über den vielen Häusern, Fabriken und Kontoren, die am Boden
liegen, von höchster Hand geschrieben:
„Kommet her und schauet die Werke des Herrn, der auf Erden solch Zerstören anrichtet, der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spiesse
zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennet, dass ich
Gott .bin." (Ps. 46, 9 f.)
Aber dieser Gott ist derselbe, der uns seinen Sohn geschickt hat, nicht „dass
er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde." (Joh. 3, 17.)
Durch seinen Sohn wissen wir, wie Gott zu uns steht: wie ein Vater zu seinen Kindern. „Als seinen Kindern begegnet euch Gott." (Hb. 12, 7.) Und e r
s t r a f t uns doch nur, weil er nicht mit ansehen kann, wie wir verkommen. Seine
47
Strafen sind doch nur Zeichen seiner Liebe. „Denn welchen der Herr lieb hat, den
züchtigt er." (Hb. 12, 6.)
Mit jeder seiner Heimsuchungen sucht Gott uns, die wir ihn verloren haben
und erfüllt die Bitte: „Bringe uns, Herr, wieder zu dir, dass wir wieder heimkommen." (Klagel. 5, 21.)
Durch den Sohn Gottes w i s s e n wir nicht nur, dass Gott Gedanken des Friedens mit uns hat, durch ihn h a b e n wir diesen Frieden, den Frieden Gottes, „der
höher ist denn .alle Vernunft." (Phil. 4, 7.)
Gott verspricht uns nicht, dass das vergangene Erdbeben unser letztes war.
Aber er verspricht uns, dass auch durch die grösste Katastrophe seine Gnade und:
der Bund seines Friedens nicht hinfällig werden.
Diese Zusicherung m a g f ü r manchen zu wenig sein, vor allem f ü r die, die'
immer mehr daran zweifeln, ob ihre K r ä f t e reichen werden, um mit all dem fertig zu werden, was die schweren Zeiten mit sich bringen. Aber was Gott uns zusagt, das ist genug f ü r uns und er will daher auch, dass wir uns damit begnügen.
„Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine K r a f t ist in den Schwachen
mächtig." (2. Kor. 12, 9.)
Mag alles wanken, mag alles fallen. Was Gott uns zusagt, das wankt und'
fällt niemals.
„Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen; aber meine Gnade
soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen,'
spricht der Herr, dein Erbarmer." (Jes. 54, 10.)
Was immer dir auch begegnet mitten im Abgrund der Welt,
es ist die Hand, die dich segnet, es ist der Arm. der dich hält.
Ob sich dein Liebstes verflüchtigt, dein Festestes splittert und stiebt,
Gedulde dem, der dich züchtigt, der heimsucht, weil er dich liebt.
Rudolf Alexander Schroeder
48
HELMUT BEISIEGEL — Frutillar
Die Konfirmation
EIN-THEOLOGISCHES UND PRAKTISCHES
PROBLEM IN UNSERER EVANGELISCHEN KIRCHE
VORBEMERKUNGEN
Im folgenden soll versucht werden, die Problematik der Konfirmation, vor
allem unseres heutigen Konfirmationsaktes, darzustellen. Dabei ist zu 'beachten,
dass die Bibel keine Konfirmation im Sinne des heutigen Sprachgebrauches kennt,
und dass die auftauchenden Probleme nicht neu sind. In den 'Evangelischen Kirchen in Deutschland bemüht man sich schon seit längerer Zeit um eine Lösung —
bisher allerdings mit wenig Erfolg, wenn .man von der mehr oder weniger „radikalen" Lösung der Evangelischen Kirche der f r ü h e r e n Provinz Sachsen — auf
die hier Bezug genommen wird — absieht. Auch ist daran zu erinnern, dass an
eine Lösung dieser Fragen nur zu denken ist, wenn alle deutschen Kirchen — und
damit irgendwie auch die deutschen Auslandskirchen und -gemeinden — gemeinsam einen Weg finden.,
ZUR GESCHICHTE DER KONFIRMATION
Die Art und Weise, wie wir heute konfirmieren, ist nur zu verstehen aus der
Entwicklung heraus, die zu unserem Konfirmationsakt von heute geführt hat.
Unsere heute praktizierte Konfirmation hat sich entwickelt aus der römischkatholischen Firmung. Diese wurde — mangels ausreichender biblischer Begründung — von den Reformatoren abgelehnt. Auch waren sie der Ansicht, dass die
katholische Firmung die Taufe verdunkele und zurücksetze. Aber die Reformatoren sahen durchaus ein, dass irgendwas nötig sei, um an die Stelle der Firmung
zu treten bzw. um die im Säuglingsalter vollzogene Taufe aufzunehmen und die
Hinführung zum zweiten Sakrament in unserer Kirche — dem Hl. Abendmahl —
zu gewährleisten.
Fünf Linien sind es, die zur heutigen Konfirmation geführt haben:
1. die „katechetische" Linie, in der die Unterweisung' im rechten Glauben die e r ste Stelle einnahm. E s fanden ziwar zum Abschluss Prüfungen oder Verhöre
statt — von einer Konfirmationshandlung ist aber nicht die Rede gewesen.
2. Die „gemeindezuchtliche" Linie. In ihr geht es in erster Hinsicht um einen
49
„Zulassungsunterricht" zum Abendmahl. Hier kommt es bald zu einem Abschlussakt, der einem Bekenntnis gleichkommt — z. T. verbunden mit der
Privatbeichte der Konfirmanden.
'
3. Die „sakramentalische" Linie. Hier wird die katholische Firmung wieder a u f genommen bzw. weitergeführt. Zwei Namen sind in diesem Zusammenhang
zu nennen: Martin Butzer (1491—1551), der das Konfirmationsgelübde und
die Handauflegung in die Konfirmationshandlung einführte. Und A. F. Chr.
Vilmar (1800—1868), der die Konfirmation als zweiten Akt neben die Taufe
stellte und sie rein sakramental verstand.
4. Die „pietistische" Linie. Sie versteht die Konfirmation als „feierliche Übergabe an den Herrn". Bekenntnis und Gelübde werden hoch geschätzt; die H i n f ü h r u n g zum Hl. Abendmahl tritt zurück. Der Mensch, der ein Bekenntnis ablegt, steht jetzt im Mittelpunkt der Handlung.
5. Die „sekulare" Linie. Im Zeitalter des Rationalismus wird die Konfirmation
zu einem Akt religiöser Jugendweihe. Es kommt in ihr zu einer Erneuerung
des Taufbundes, nachdem die Taufe zum Ritus der Aufnahme in die Christenheit geworden ist. Da Schulentlassung und Konfirmation meistens zeitlich zusammenfallen, wird die Konfirmation wohl oder übel zu einer Art „Reifefeier", zu einem Abschlussakt, vergleichbar in etwa — m a n verzeihe den Ausdruck — dem Mannbarkeitsritus bei heidnischen Stämmen.
Diese fünf — oder mit der Firmung sechs — Linien haben sieh im Laufe der
Zeit vielfältig miteinander verschlungen und finden sich heute vereint in dem
Konfirmationsakt, den wir Pastoren mit Zustimmung der meisten Gemeindeglieder fröhlich und ohne grosse Bedenken praktizieren. Dass zum mindesten drei
dieser Linien trotz mancher berechtigter Anliegen unevangelische und unbiblische Züge tragen, sollte eigentlich unbestritten sein. Ich meine die „sakramentalistische", die „pietistische" und die „säkulare" Linie.
Aber bevor wir versuchen, die Konfirmation von den beiden anderen Linien
— der „katechetischen" und „gemeindezuchtlichen" — her neu zu verstehen und
aufzubauen, sollen die theologischen und praktischen Grundlagen
untersucht
werden,
DIE KONFIRMATION ALS THEOLOGISCHES PROBLEM
Aus der Geschichte der Konfirmation ist ersichtlich, dass zum mindesten in
reformatorischer Zeit die Konfirmation nur eine Hilfsfunktion inne hatte, das
Gewicht einer besonderen Würdigkeit gewann sie erst später.
Wir haben uns daher zu fragen, ob die Konfirmation als der Akt, der ein Mal
im Leben vollzogen wird, auf den die meisten Gemeindeglieder so grossen Wert
legen, theologisch, d. h. biblisch zu begründen ist.
Vorweg: Die Konfirmation als einmaliger Akt im Sinne einer besonderen
Handlung lässt sich theologisch nicht rechtfertigen.
Confirmatio = Festigung (das lateinische Wort f ü r die katholische F i r mung), kann nur verstanden werden so, dass wir alle — immer wieder — der F e stigung, d. h. der Heiligung, der Stärkung, der Tröstung bedürfen. Dieses geschieht aber allein durch Jesus Christus selber, wenn wir das „Christus solus"
50
der Reformation ernst nehmen. E r ist also immer und stets das Subjekt, das an
uns handelt; e r allein hält uns über dem Abgrund der Hölle. Und sein Wort und
seine beiden Sakramente sind die Mittel, mit denen er das tut. Bedürfen sie etwa
einer Ergänzung durch andres? Geschieht aber — und sie muss und wird immer
wieder geschehen — confirmatio durch Wort und Sakrament, dann ist eine einmalige Konfirmationshandlung nicht nur nicht notwendig, sondern sie widerstreitet auch dem eigentlichen Verständnis der confirmatio. Unser Leben bedarf
immer wieder der „Festigung" — wie sollte die in einem einmaligen, besonderen
und dazu noch so differenzierten Akt zum Ausdruck kommen und kommen
müssen?
Lässt sich der Konfirmationsakt von der Kindertaufe her begründen?
Dieser Einwand ist zu hören, da Taufe und Konfirmation in einem engen Zusammenhang immer wieder gesehen werden.
Wenn wir aber die Kindertaufe ernst nehmen — und die Mehrzahl unserer
Pastoren tut dies wohl noch, obwohl sich mancherlei Bedenken dagegen erheben
— dann müssen wir zugeben, dass auch die Kindertaufe in keiner Weise ergänzungsbedürftig ist. Notwendig ist allein die nachfolgende Unterweisung. Und da
kann es dann allenfalls eine P r ü f u n g des V e r s t ä n d n i s s e s geben, nie eine
P r ü f u n g des Glaubens. Wer von uns wollte dies (eine P r ü f u n g des Glaubens) wagen und auf sich nehmen, und wie sollte man das machen? Mit dem Hinweis auf
die Kindertaufe lässt sich also ein besonderer Konfirmationsakt nicht begründen,
es sei denn, wir nähmen die Kindertaufe nicht f ü r vollgültig.
Ebenso verhält es sich mit dem Einwand, ob die Zulassung zum Hl. Abendmahl einen besonderen Akt bedingt. Man kann allenfalls einen Menschen nach
seinem Abendmahls V e r s t ä n d n i s fragen, man kann wohl auch aus kirchenzuchtlichen Erwägungen diesen oder jenen vorerst zurückstellen.
Aber es ist
nicht einzusehen, warum neben einem seelsorgerlichen Gespräch — einer Befragung und Tröstung und Hilfe — ein besonderer Akt notwendig sein sollte,
wenn die Kinder zum ersten Mal zum Tisch des Herrn gehen.
Und etwa von dem Gesichtspunkt der Sammlung einer verantwortlichen Gemeinde her lässt sich die Konfirmationshandlung überhaupt nicht rechtfertigen,
da eine klassifizierende Unterscheidung der Gemeinde dem Neuen Testament widerspricht. Nach evangelischem, biblischem Verständnis gibt es keine besondere
„Kerngemeinde" und daneben dann noch eine „Mitläufergemeinde". Die Eingliederung in den Leib Christi — seine Kirche — ist immer ein Werk des Heiligen,
Geistes, wobei wir Gehilfen sein dürfen. Und der Akt der Eingliederung ist allein die Taufe — ob nun Kinder- oder .Erwachsenentaufe — und durch Predigt
und Abendmahl und den dadurch geweckten und geförderten Glauben wird diese
Eingliederung immer wieder gefestigt. Neben dem Sakrament der Taufe kann es
und darf es keinen anderen Akt der Eingliederung mehr geben, sonst nehmen
wir die Taufe als Tun Gottes nicht ernst. Wohl dürfen und müssen wir immer
wieder auf die Taufe zurückgreifen in Mahnung und Zuspruch; aber entscheidend
vollzieht sich die Eingliederung in die Gemeinde, die Konkretisierung des „Machet zu Jüngern" von Matthäus 28 in Taufe und Unterricht.
Es sei hier gestattet, noch einen kurzen Blick zu werfen auf die beiden Hand51
lungen, die in unserem Konfirmationsakt immer noch eine grosse Rolle spielen:
die Handauflegung und das Gelübde.
Im Neuen Testament finden sich Beweise f ü r die Handauflegung durch J e sus oder die Apostel nur in geringer Zahl. Die römisch-katholische Kirche hat
sie in die Firmung hineingenommen, bzw. sie zur Begründung der Firmung als
Sakrament benutzt. Wie schon erwähnt, hat Butzer diese Handauflegung aufgenommen; er versteht sie als Mitteilung des Heiligen Geistes und damit als Vollendung der Taufe.
Die Handauflegung gilt aber in unserer Kirche nicht als Sakrament, da sie
nicht auf eine besondere Stiftung Gottes zurückzuführen ist. Auch als Mitteilung
des Heiligen Geistes kann sie nicht verstanden werden. Ist sie also nicht mehr
als ein begleitendes Zeichen, eine B i t t e um den Heiligen Geist, ein f ü r b i 11 e nd e r Z u s p r u c h , dann ist nicht einzusehen, wieso sie einen besonderen, einmaligen Konfirmationsakt begründen sollte.
Das zur heutigen Konfirmation gehörende Gelübde — in weitaus den meisten
Fällen wird es noch „abgenommen" — macht die eigentliche Not unseres Konfirmationsaktes deutlich.
Wie hat die Kirche in Deutschland während des Dritten Reiches gegen die
„Massengelübde einer unfertigen Jugend" sich zur Wehr gesetzt — und sie selber übt diese Praxis bis zum heutigen Tag! Haben wir ein Recht, ein solches Gelübde zu verlangen? Gibt es überhaupt eine theologische Begründung f ü r einen
solchen Eid? Im Neuen Testament sehen wir auf jeden Fall, dass ein Petrus mit
seinem Gelübde -gescheitert ist. Wohl gibt es in der Bibel das zaghafte J a des Glaubens zu dem gegenwärtigen Herrn. Aber ist es da nicht immer so, dass an einer
solchen Stelle deutlich wird: „Teneo quia teneor" („Ich halte, weil ich gehalten
werde")? Und wenn wir die in der Bibel sichtbar werdende confirmatio als i m merwährendes Ereignis und notwendige Tat Gottes ernst nehmen, kann es dann
überhaupt ein Gelübde geben? •
' Im Reformvorschlag zur Konfirmation der Sächsischen
Provinzialsynode
heisst es: „Es gibt im Grunde nur die Alternative:
entweder Ja zum Gelübde und damit Nein zur Notwendigkeit und zum Wesen
der confirmatio,
oder J a zur Wirklichkeit der Anfechtungen und damit zur Notwendigkeit immerwährender confirmatio und damit Nein zum Gelübde".
Und soll etwa dieses so fragwürdige und gefährliche Gelübde den Konfirmationsakt begründen? Fragen wir uns doch selber, inwieweit wir unserem Konfirmations- oder auch Ordinationsgelübde — treu geblieben sind — ob wir
überhaupt treu bleiben konnten?
Wer das Gelübde ernst nimmt, nimmt sich selber zu ernst, und damit nicht
mehr die Gnade Gottes, die uns nicht nur trägt und hält, sondern auch zu seiner
Zeit den Mund öffnet.
Durch das Gelübde werden die Konfirmanden selber zu Handelnden — wo
der Herr der Kirche allein handeln sollte und will.
Abschliessend ist zu sagen:
Die Konfirmation in ihrer heutigen Gestalt ist theologisch nicht zu begründen. Die Entwicklung hat uns einen Weg geführt, der nicht nur äusserst bedenk52
lieh sondern unbiblisch ist. Sie bedenkenlos weiterzuüben, bedeutet Unehrlichkeit,
Feigheit und Schuld. Die Kirche der früheren Provinz Sachsen hat diesen Bann
durchbrochen, hat dabei allerdings auch manches an Anschuldigungen über sich
ergehen lassen müssen.
DIE KONFIRMATION ALS PRAKTISCHES PROBLEM
Es bedarf unter uns wohl keiner Frage, dass die Ordnungen einer Kirche —
und darum handelt es sich bei der Konfirmation — ihrem Wesen entsprechen
müssen. Ferner ist wohl unbestritten, dass diese Ordnungen sich immer wieder
von der Bibel her f r a g e n lassen müssen, ob sie wirklich in echter Weise der Verkündigung dienen, dem Herrn der Kirche Raum geben. Eine Kirche hat daher
durchaus die Möglichkeit, aufgrund neuer Erkenntnisse ihre Ordnungen zu ä n dern, sie einer scharfen Kritik zu unterziehen, da diese Ordnungen nun einmal,
sofern sie nicht deutlich aus der Bibel abzulesen sind, menschlichen Irrungen und
Wirrungen unterworfen sind. Eine Kirche, die allein deshalb ' am Alten klebt,
weil es alt ist, oder weil die Gemeinde die Tradition zu einem ihrer Götzen gemacht hat, wird zu einem Museum. Eine Kirche, die ihrem A u f t r a g treu bleiben
will — das Wort Gottes heute und hier und den Menschen ihrer Zeit zu sagen —
wird immer das Recht haben und Gebrauch davon machen müssen, ihre Ordnungen zu ändern, vor allem, wenn sie theologisch und praktisch fragwürdig geworden sind. Und das gilt imgrunde f ü r alle unsere sog. Amtshandlungen, in erster
Linie heute f ü r die Konfirmation, aber auch f ü r die kirchliche Trauung mit ihrem Gelübde und den sog. Trauerfeiern bei der kirchlichen Bestattung.
Wer längere Zeit als Pastor im Gemeindepfarramt gestanden hat, hat sich
sicherlich schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie es eigentlich kommt, dass
die Konfirmation in der Gemeinde so beliebt, die Konfirmationsgottesdienste (neben der Christmette oder -vesper) die meistbesuchtesten Gottesdienste
sind.
Liegt es vielleicht daran, dass wir bei solchen oder ähnlichen Gelegenheiten zu
viele Konzessionen an die bürgerliche Welt und das Denken unserer Gemeindeglieder machen und das Eigentliche unseres Auftrages zurücktreten
lassen?
Kommt es daher, dass wir gerade in diesen Gottesdiensten sehr stark an das Gefühl der Menschen appellieren, sie mit allem möglichen liturgischen Zauber und
musealer Feierlichkeit zu interessieren und zu packen versuchen? Wir sollten
uns vor allem einmal wieder ganz ernst darauf besinnen, dass die Predigt noch
immer das Herzstück des evangelischen Gottesdienstes ist, und dass alles a n dere sich fragen lassen muss, ob es als Stütze oder schmückendes Beiwerk wirklich notwendig ist.
Und nun spielt es f ü r die Konfirmation als praktisches Problem keine grosse
Rolle, ob wir hier in Chile in einer sog. „Freiwilligkeitskirche" leben oder in einer
sog. „Volkskirche" Deutschlands, die im Grunde ja doch nur noch eine Fassade
ist. Um beider willen lohnt es sich nicht, eine bisher geübte Praxis am Leben zu
erhalten. Nicht nur, weil wir als Pastoren uns schuldig machen an unseren Konfirmanden, vielmehr noch, weil die grosse Gefahr dahinter steht, dass wir unsere
Konfirmanden zu Heuchlern erziehen oder sie bestenfalls f ü r dumm verschleis53
sen. Es gibt f ü r unsere Kirche auch hier in Chile nur den einen Weg, der Verheissung hat: den Weg zu einer G e m e i n d e k i r c h e. Die Zahl der Mitglieder darf
dabei keine Rolle spielen, erst recht keine finanziellen Erwägungen. Die Kirche
ist kein Verein, der gerufen werden kann, an einigen Grenzsituationen des Lebens zur Erhöhung der Feierlichkeit beizutragen. Sie hat allein die frohe Botschaft ihres Herrn zu verkündigen in Wort und Sakrament — aber dies hat sie
allein zu tun in Verantwortlichkeit und Treue gegenüber ihrem H e r r n .
Aus diesen Erwägungen heraus gilt es nun zu fragen, ob man die bisherige
Form des Konfirmationsaktes und der Konfirmation noch beibehalten kann. Die
theologische Unmöglichkeit der Konfirmation habe ich aufzuzeigen versucht.
Was ist praktisch dazu zu sagen?
1. Jeder Pastor — aber auch jedes einsichtige Gemeindeglied — sieht, dass die
Konfirmation in unserer Kirche — und nicht nur bei uns — zu einem Abschlussakt geworden ist. Wer konfirmiert ist, ist fertig — fertig zum grossen
Teil auch mit der Kirche. Man wird unter kirchlichem Segen „entlassen" —
am Religionsunterricht in der Schule braucht man weiter — das ist bei uns
eine weitverbreitete Meinung — nicht mehr teilzunehmen. Wir konfirmieren
aus der Kirche heraus — nicht in sie hinein.
2. Es gibt auf der Welt manche evangelische Kirchen, die die Konfirmation überhaupt oder noch nicht sehr lange oder nur fakultativ 'kennen.
3. Die Masse der Elternhäuser ist in ihrem praktischen Verhalten entweder negativ oder zum mindesten betont gleichgültig oder der bestehenden Sitte u n tergeordnet. Mit der Konfirmation wird die Mehrzahl der Konfirmanden genau so unkirchlich wie ihre Eltern. Und eine Gemeinde, die diese negativen
Einflüsse der Elternhäuser und auch der Umwelt aufzufangen vermag, ist
weithin nicht mehr vorhanden.
4. Der Zwang zur Konfirmation ist mehr als verderblich und nicht zu verantworten. Wer gibt uns Pastoren das Recht, die Gemeindezugehörigkeit von dem
Besitz des Konfirmationsscheines abhängig zu machen und nicht von der T a u fe nebst folgendem Unterricht?
5. Auch die völlig veränderte Umwelt lässt es äusserst fragwürdig erscheinen,
14 Jährige in einem besonderen Akt zu mündigen Gemeindegliedern zu e r kläre!!.
Selbstverständlich soll man auch das andere sehen,
1. dass auch die kirchliche Sitte ein wesentliches Element ist und segensreiche
Folgen haben kann, vorausgesetzt natürlich, dass diese Sitte theologisch und
praktisch vertretbar ist,
2. dass Konfirmation und Abendmahl — vor edlem der erste Gang zum Tisch des
Herrn — positive Eindrücke f ü r das ganze Leben zu hinterlassen vermögen.
Alles in allem aber sprechen viele praktische Gründe gegen eine Beibehaltung
der Konfirmation in der bisherigen Form. Vielleicht muss man nicht unbedingt
mit Kierkegaard von dem „christlichen Komödienspiel der Konfirmation" sprechen, aber eine Neuordnung ist- um der Wahrhaftigkeit willen anzustreben.
DIE NEUORDNUNG DER KONFIRMATION
In diesem abschliessenden Abschnitt kann ich mich kurz fassen; es handelt
sich um einzelne Vorschläge.
Es gilt, das Anliegen der Reformatoren betr. Konfirmation wieder aufzunehmen: die „katechetische" und die „gemeindezuchtliche" Linie. Mit anderen W o r ten: Der „Taufbefehl" Jesu mit dem „Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe" und seine Abendmahlsworte „Solches tut zu meinem Gedächtnis"
sind vor den Getauften bzw. denen, die die Taufe verlangen, auszubreiten.
Die kirchliche Unterweisung hat also unter der Überschrift zu stehen: V o n
der T a u f e her — zum A b e n d m a h l
h i n ! Konfirmandenunterricht ist
— bei der heutigen Praxis der Kindertaufe — nachgehoHer Taufunterricht. Damit kommt die Ansicht der Reformatoren voll zu ihrem Recht. Zum Abschluss
sollte eine Katechese oder auch eine Befragung erfolgen — aber nur in Gegenwart der Eltern und der Kirchenvorstände. Eine allgemeine ö f f e n t l i c h e P r ü fung sollte nicht mehr sein um der Kinder willen.
In welchem Alter man mit dem Unterricht beginnen soll, ist eine Streitfrage.
Vielleicht ist das 12. Lebensjahr noch immer das beste.
Die Zulassung zum Hl. Abendmahl sollte abhängig gemacht werden von der
Teilnahme am Unterricht und einem gewissen Mindestmass des Bescheidwissens.
Es f ü h r t zu weit, an dieser Stelle die Bedeutung des Hl. Abendmahles zu entfalten. E s kommt aber ganz darauf an, was das Abendmahl f ü r uns ist: ein Akt des
Bekennens und des Gehorsams verantwortlicher Gemeindeglieder oder die Tatsache, dass wir alle — ob jung oder alt — „unwürdige Gäste" an seinem Tisch
sind. Und ob unbedingt ein Erwachsener mehr vom Abendmahl weiss oder versteht als ein Kind, das ist immer noch eine Frage.
Diese Zulassung aber zum Hl. Abendmahl sollte auf keinen Fall — wie auch
der erste Gang zum Tisch des Herrn — in einen besonderen Akt hineinverlagt
werden —• vor allen Dingen kein Gelübde irgendwelcher Art!
Das Patenamt kann nur der übernehmen, der in der Gemeinde und mit der
Gemeinde lebt. Es allen — wie es heute geschieht — mit der Konfirmation zu
verleihen, ist verantwortungslos. Zu Übernahme des Patenamtes in unserer Kirche würde ich f ü r „würdig" halten, die sich am gottesdienstlichen Leben rege
beteiligen und mindestens 18 Jahre alt sind.
Ebenso würde ich es mit der Verleihung der anderen kirchlichen Rechte und
Pflichten halten (aktives und passives Wahlrecht, Beitrag zu den Lasten der Gemeinde).
Eines müssen wir uns vor Augen halten:
Mehr als bisher haben wir bei der Taufe darauf zu achten, ob die unbedingt
notwendige und gebotene evangelische Unterweisung in Schule und Kirche gewährleistet ist.
Und mehr als bisher haben wir die Erwachsenentaufe zu berücksichtigen, bei
der die Unterweisung voranzugehen hat.
55
ZUM ABSCHLUSS
Die vorliegende Untersuchung hat die Aufgabe gehabt, die Probleme um die
Konfirmation aufzuzeigen. Ich bin mir darüber im Klaren, dass unsere Kirche
hier in Chile keinen Alleingang unternehmen kann, obwohl dies bei uns wesentlich leichter wäre als etwa in Deutschland, wo die Kirchen eng miteinander verbunden sind. Die Untersuchung wie die Vorschläge zur Neuordnung wollen vor
allem
1. wieder ernst machen mit der Taufe Eds Zueignung des Heils durch die Eingliederung in die Kirche als Leib Christi,
2. den „Taufbefehl" Jesu und seine Abendmahlsworte in das rechte Licht r ü k ken und auswerten f ü r die sog. Konfirmation,
3. den Weg zu einer echten Gemeindekirche aufzeigen.
Anfangen könnte man hier in unserer Kirche ganz praktisch damit, dass man
eben nicht mehr den Besitz des Konfirmationsscheines f ü r die Gewährung der
Amtshandlungen und aller anderen kirchlichen Rechte und Pflichten verlangt,
sondern die Teilnahme an der kirchlichen Unterweisung, ein gewisses Mass des
Bescheidwissens und die rege Teilnahme am gottesdienstlichen Leben der Gemeindtf.
56
CLAUS von PLATE — Santiago
„Mein geliebtes Santiago"
„ALS OB ES GOTT GESCHAFFEN HABE, UM ALLES BEI DER HAND
ZU HABEN!"
Der Conquistador und Städtegründer Pedro
de Valdivia 1545 an S. M. Kar] dem V. von
Spanien.
Der kritischen Grundhaltung des Chilenen mag es zugesprochen werden, dass
wir aus Literatur oder auch nur als Presseartikel nichts Herausragendes besitzen,
was wir als eine Art „Hohelied" unserer Landeshauptstadt Santiago verzeichnen könnten. Wir kennen doch manche andere Stadt, nicht nur im alten E u ropa, sondern auch in unserem südamerikanischen Raum, die in vielgestaltiger
Form besungen worden ist. Wird Santiago ob ihrer Schönheit und Pracht einmal
hervorgehoben, so sind es Stimmen durchreisender Fremder, denen es die Stadt
besonders angetan hat. Dabei können wir selber diesen Fremden auf Anhieb garnicht sagen, was diese Stadt so liebenswert macht, noch weniger, was sie f ü r Sehenswürdigkeiten birgt — ein Umstand, der uns Durchreisenden gegenüber, die
danach fragten, schon oft in Verlegenheit brachte.
Es gibt Städte, die wegen eines einzelnen Bauwerks berühmt sind, andere wegen der Schönheit ihres Städtebildes; wieder andere in Folge eines geschichtlichen
Ereignisses oder weil ein bedeutender Mensch in ihr geboren wurde. Oft hat auch
eine Fabrik oder ein bestimmtes Erzeugnis den Namen einer Stadt bekannt gemacht. Santiago aber ist nur Landeshauptstadt und es gibt sicherlich wirkungsvollere. lebhaftere und modernere Städte auf der Welt. Was also ist es, das den
Fremden so antut und was den Zugezogenen in Santiago so bald heimisch werden Jässt?
AuJ diese Frage eine Antwort geben, ist nicht leicht! Es kommt da vieles zusammen und Eingenommenheiten wie Voreingenommenheiten bestimmen zu leicht
das Empfinden. Der Provinzler sieht in Santiago vornehmlich den Wasserkopf
Chiles und ist der Stadt von daher schon nicht gut. Der oberflächliche Betrachter
empfindet den Mangel einer sichtbaren Vergangenheit und meint, die Stadt habe
keine Geschichte. Der Santiaguiner selber zeigt keinen ausgesprochenen Stolz,
Bürger seiner Stadt zu sein, einen gesunden lokalen Stolz meinen wir, wie er etwa
in einigen Provinzstädten so fein hochgezüchtet worden ist. Auch gibt es den typischen Santiaguiner in der Art nicht, wie ihn sich andere südamerikanische Gross57
Städte — etwa den Paulist aner (Sao Paulo),, den Limeño (Lima) geschaffen haben. Vielleicht liegt das daran, dass die meisten Bewohner unserer Landeshauptstadt garkeine ursprünglichen Santiaguiner, sondern vielmehr Zugezogene sind,
sei das aus den weiten Provinzen des Landes oder aus dem Auslande. Aber auch
das ist keine Erklärung f ü r den geringen lokalen Stolz und die mangelnde Typisierung, die wir am Santiaguiner feststellen, denn fast alle Grosstädte der Welt
sind zu einem beachtlichen Prozentsatz von Zugezogenen bewohnt, die sich meist
doch sehr schnell den typischen Lebensgesetzen dieser Stadtgemeinschaften unterstellen und ihnen Ausdruck verleihen.
Hierin aber scheint gerade eine Eigentümlichkeit Santiagos begründet zu sein:
ihr Herz ist so weit und ihr Sinn so aufgeschlossen, dass sich jeder Lebensstil darin ausleben k ^ m . Das macht den Zugezogenen hier so schnell heimisch, auch
wenn die Stadt nichts Heimeliges oder gar Warmes a n sich hat. Aber hier kann
jeder nach seiner Facon selig werden, kann im Bereich seiner Möglichkeiten am
Gesicht der Stadt mitgestalten. Das zeigt sich vor allem in dem verschiedenartigen
Baustil, den manche Strassen unserer Landeshauptstadt trotz Baudirektion und
Bauvorschriften aufweisen, manchmal ein herzbeklemmendes Vielerlei, das sich
aus diesem hier eigentümlichen „Leben und leben lassen" erklärt.
Bei aller Grösse — Santiago ist flächenmässig wohl eine der ausgebreitetsten
Städte der Welt — weist sie bei ihrem nüchternen und schnellen Umtriebe dennoch
nichts Übertriebenes noch Hervorragendes auf, es sei denn, dass wir das bestechende Klima und die umliegende Landschaft in ihrer Grossartigkeit dazu rechnen. Die Sonne und die Majestät der Andenkette sind es, die Santiago wohl die
stärkste Eigentümlichkeit aufprägen. Das hat schon den Begründer, den Conquistador Pedro de Valdivia a m meisten beeindruckt, als er in seinem werbenden
und gerade deshalb um manches übertriebenen Schreiben vom 4. September 1545
an seinen König Karl V. von Spanien darüber berichtet. Dieser Brief, am Fusse des Santa Lucia längs der Alameda Bernardo O'Higgins in Stein gehauen, bringt
jeden Passanten die Vorzüge dieser Stadt wieder in Erinnerung:
„Und damit es den Handelsmännern und allen Leuten, die sich hier niederlassen wollen, gesagt werden kann: sie sollen kommen, denn es gibt auf
Erden kein schöneres Land um darin zu leben und sich zu verewigen. Ich
sage dies, weil es so eben geschaffen ist, gesund und voll grosser Freuden;
wir zählen hier nur vier Wintermonate, die innerhalb jedes Mondwechsels
nicht mehr als ein bis zwei Regentage verzeichnen; alle anderen Tage scheint
eine Sonne, dass man sich keinem Herdfeuer nahen braucht. • Der Sommer
ist lind und es wehen so erfrischende Lüfte, dass man den ganzen Tag in der
Sonne spazieren kann, ohne sich ihrer Wärme auszusetzen. Ein Reichtum
an Wiesen und Weiden, um jede Art Vieh zu halten und Pflanzen, die sich
malen lassen, wertvolles und schönstes Holz, um Häuser zu bauen, eine Unmenge Brennholz f ü r die Hauswirtschaft und reiche Goldminen, und das
ganze Land ist übersät davon, und wc man es auch ausbeuten will, da findet
man auch alles Notwendige zum Säen und Bauen, und Wasser und Futter
für das Vieh,, als ob es Gott geschaffen habe, um alles bei der Hand zu haben."
58
Zieht man die Übertreibungen ab, die der Conquistador in diesem Brief mit
der guten Absicht niederlegte, die europäische Auswanderung auch in diesen entfernten Winkel zu lenken, so wird man ihm zugute halten, dass er damit die erste
gültige Darstellung über Lage und Beschaffenheit unserer Landeshauptstadt niederschrieb. Mag auch im Verlauf der Jahrhunderte sich manches geändert haben,
die Wesenszüge blieben. Wer immer sich in Santiago niederliess, hat die kühlen
Nächte eines langen Sommers und die wärmende Senne eines kalt-trockenen Winters gepriesen.
Die Städtegründer liessen sich längs des damals noch breiten Flussbettes des
Mapocho, vom einstigen Hügel "Huelen" — heute Santa Lucia — Richtung Küste
nieder. So ist die Stadt während der Kolonialzeit immer in dieser Richtung gewachsen um sich in den Anfängen der Republik gen Süden auszudehnen. Das
heute immer stärker zu beobachtende Anrücken den Hängen unserer Anden zu,
also die Ausdehnung nach Osten, hat erst in unserem Jahrhundert begonnen, als
sich der Nordeuropäer in grösserer Zahl hier niederliess. Der ursprüngliche Santiaguiner ist kein unbedingter Naturfreund, er stand unseren Bergen und noch
mehr, unserer so nahe liegenden Hochkordillere innerlich eher feindlich als freundlich gegenüber. Sie waren der Inbegriff unüberwindbarer Natur-Hindernisse, in
denen man leiderfüllte Strapazen über sich ergehen lassen musste. Wieviele, die
nach Minenschätzen auszogen — und nur solches Bemühen war dem Einheimischen
bei diesem Wagnis verständlich, — waren nicht zurückgekehrt. Ausserdem vermittelten die winterlich tief beschneiten Berge das Gefühl des Abgeschnittenseins
von der Welt, die der aufgeschlossene Chilene immer in Europa — vor allem
Frankreich — verstanden hat. Und der kürzeste Weg des einst so rudimentären
Nachrichtenwesens, ging durch die hohen Pässe unserer Anden, die winters
über verschneit, jede Verbindung vereitelten. So sind unsere Berge stets als Hindernis, nicht aber als eine zu erschliessende Naturschönheit empfunden worden.
In einem Lande, dessen Sprache zudem das Wort „wandern" nicht aufweist, weil
es begrifflich nicht erlebt wird, zog man folgerichtig lieber ab von den Bergen,
die nur Ungeheuerliches bargen. Erst die Niederlassung nordeuropäischer Familien, die eine andere Einstellung zur Natur und damit zu den Bergen mitbrachten
und bis zur Jahrhundertwende in grösserer Anzahl in Santiago selber nicht beheimatet waren, sondern im Süden des Landes und im Hafen von Valparaiso, hat
die Stadt auch nach Osten ausbreiten lassen.
Es ist in dieser Sicht wohl bezeichnend, dass der einzige Deutsche unter den
Stadtgründern, der aus Worms gebürtige Bartolomaeus Blumen und spätere Flores, sich unter den zur Verfügung stehenden Plätzen der beginnenden, kleinen
Stadtgemeinde, gerade denjenigen aussuchte, der in damaliger Zeit der Cordillere
am nächsten lag. Das war am Fusse des Santa Lucia, wo er seine Mühle errichtete und wo heute die Calle Merced am Hügelhang mündet. Wer denkt beim passieren dieses Platzes, an dieses erste Mühlenwerk Chiles, das mit Wassern des
Mapochc getrieben wurde? Wer denkt heute angesichts der aufgeschossenen Hochhäuser an die traurig berühmt gewordene Catalina de los Rios — genannt Quintrala — Nachfahrin dieses ersten Deutschen, die in ihrem Hause gegenüber der
Au gustiner-Kirche (heute Ecke Estado) ihren zügellos-sadistischen Trieben nachging? J a ! — Santiago hat eine Vergangenheit, sie ist jedoch in ihren Ausdrueks59
formen durch Erderschütterungen oder durch den Zwang der Entwicklung verschüttet und wird uns heute nicht mehr gewahr. Der geringe Sinn des Santiaguiners f ü r geschichtliches Werden, der auf gleicher geistiger Ebene zu verstehen
ist wie sein mangelnder lokaler Stolz, mögen nicht minder zu der geschichtslosen
Athmosphäre beitragen, die diese Stadt auf jeden Fremden ausstrahlt.
Doch wollen wir den Faden wieder aufgreifen und der städtischen Ausdehnung
den Hängen der Cordillere zu nachgehen. Wiewohl die deutschen, englischen und
skandinavischen Familien zu Beginn unseres Jahrhunderts sich im eigentlichen
Stadtinnern zwischen der Plaza de Armas und der Quinta Normal niederliessen,
meist den damals gültigen maurischen Baustil nacheifernd, der den nach aussen
abgeschlossenen Hof mit den umliegenden Zimmerreihen darstellte, so verzogen
sie sich doch in den zwanziger und dreissiger Jahren immer zahlreicher in die
damals werdenden Villenviertel von Providencia, Las Condes und Ñuñoa, immer
der Cordillere näher, wo sie vielfach dem überlieferten Baustiel ihrer angestammten Heimat in moderneren Formen Gültigkeit verschafften.
Diese Umsiedlung in die höher gelegenen, sich immer weiter ausbreitenden
Stadtteile des zugezogenen europäischen Elementes, dem dann alteingesessene F a milien vielfach nachzogen, geschah in der selben Zeit, da die Hochkordillere im
Raum von Santiago von wanderfreudigen Männern — meist Deutsche — immer
mehr erschlossen wurde. Auf Ferientouren, aber auch in Wochenendausflügen
erstiegen sie die 5- und 6-Tausender, zogen in die näher gelegenen Täler der vorgerückten Cordillere, errichteten die erste Schutzhütte der Anden — Lo Valdes —
und waren die ersten begeisterten Sportler, die den heute so volkstümlich gewordenen Skisport ausübten.
Heute werden unsere Berge nicht mehr als Hindernis empfunden. Heute sind
sie das sportliche Ziel der Besten unserer Jugend und sind mit ihren Gaststätten
und Wochenendhäusern zu einem Ort der Erholung und Entspannung geworden
Vor allem aber umspannen die Berge wie ein Wahrzeichen dasiBild der Stadt und da
sie keine weichen Konturen aufzeigen, sondern eher hart und trotzig wirken, so
ist auch das allgemeine Stadtbild Santiagos von keiner Lieblichkeit, vielmehr von
einer den Bergen ebenbürtigen Erhabenheit geprägt.
Es gibt Menschen, die ob solchen immerwährenden Empfindens, von Zeit zu
Zeit versucht sind, der Stadt zu entfliehen, und Santiago besitzt den Vorzug, nicht
nur seinen Bergen, sondern auch seiner Küste nahe zu sein. Seitdem eine Betonstrasse die Landeshauptstadt mit den Küstenortschaften verbindet, sind zu den
einstigen kleinen Fischerdörfern am Meeresstrand Villenviertel neben Villenviertel entstanden, die sich den langen Sommer über und in den Feiertagen des Jahres
mit den nach Meeresluft hungernden Grosstadtbewohnern füllen. So kann der
glückliche Santiaguiner Kraftwagenbesitzer in ein-einhalb Stunden Fahrt sowohl
die Hochkordillere, als auch den Meeresstrand e r r e i c h e n . . . . " als ob es Gott geschaffen habe, um alles bei der Hand zu haben!".
So weitgelockert in die Breite, so vielgestaffelt und in bunter Abwechslung
ist Santiago erst in den letzten 30 Jahren zur Grosstadt gewachsen. Eine Grossstadt? — Man möchte lieber sagen: eine grosse Stadt. Wenn auch eine Millionenstadt, so birgt sie insofern doch eine gewisse Intimität, als sich hier — wie in ganz
Chile — ein jeder kennt. Diese Feststellung darf nicht wörtlich genommen werden,
60
sie enthält jedoch ein Fünkchen. Wahrheit. Ein Freund, nach europäischem Studienaufenthalt ins heimatliche Santiago zurueckgekehrt, meinte im Gegensatz zur
alten Welt, dass ihm hier f a s t alle Gesichter bekannt seien. In der Tat hat der
Chilene, vor allem die F r a u e n , etwas an sich, was ihn von anderen absticht, womit
sich eine wie immer geartete ähnliche Zurschaustellung ergibt. Aber auch sonst
ist das untereinander Bekanntsein eine Eigentümlichkeit dieser Stadt, gibt es doch
k a u m eine Behördenstelle, wo auch ein Zugereister nicht nach einigem Suchen
einen Bekannten finden wird, der ihm in liebenswürdiger Weise hilft. Und wer
im öffentlichen Leben — und sei es auch ein noch so untergeordneter Posten —
je gewirkt hat, ist den Santiaguinern mit seinen Tugenden oder Untugenden sehr
schnei] ein Begriff.
Doch die weit: m e h r als 1% Millionen zählenden Einwohner Santiagos leben
hier auch in anderer .Sicht nicht wie Grosstadtmenschen, wie sie etwa die Massenwohnungen unserer Zeit hervorgezüchtet haben, sondern eigentlich in abgezirkelten Kreisen, die sich einander zwar nicht ausschliessen und als Teile zum Ganzen
streben, aber doch ein Leben f ü r sich zu gestalten suchen. Da sind einmal die alteingesessenen Familien der höher gestellten Gesellschaftsschicht, dann die vielen
vom Ausland her geprägten Gruppen, einst Kolonien, heute "colectividades" genannt, da sind die niederen Volksschichten, in mannigfachen Schattierungen und
Ausrichtungen, alles grosse und grössere Kreise, die unabhängig von einander ihre
Lebensweise f ü h r e n und doch der ganzen Stadtgemeinschaft gegenüber a u f g e schlossen und zugetan bleiben. Die vielen Querverbindungen
innerhalb dieser
Kreise, die sich durch Beruf, politische Ausrichtung, Konfession u. a. m. so leicht
ergeben, verhindern wie von selbst jede Eigenbrödelei. Es ist dies ein Grund mehr
dafür, w a r u m der Zugezogene, hat er den Anschluss an den ihm zusagenden Kreis
einmal gefunden, in Santiago so leicht F u s s zu fassen vermag. Diese ganz auf
sich selber gestellten Gruppen haben aus eigenem Antrieb sich ihre Sportanlagen,
ihre Kirchen und Schulen geschaffen und mit ihren Baulichkeiten vielfach zur
Ausbreitung und Verschönerung der Stadt beigetragen. Das gilt auch auf w i r t schaftlichem Gebiete, zumal die Vertreterfirmen und Bankinstitute ausländischer
H e r k u n f t mit ihren aufgeschossenen Etagenbauten das Bild der Innenstadt Santiagos ganz wesentlich mitbestimmt haben. Der einstige maurische Baustil aus
der Kolonialzeit, der in einigen Stadtbezirken noch zu sehen ist,, wird immer s t ä r ker zurueckgedrängt.
—
So ist Santiago im Stadtbild eine europäische Metropole geworden. Geblieben
sind lediglich die rechteckigen Häuserblocks von 125 Meter Durchmesser, wie sie
die S t a d t g r ü n d e r vorsahen und dieses Gesetz der gradlinigen ost-west und nordsüd ausgerichteten Strassen, nach dem die S t a d t einst angetreten ist, ist eigentümlicher Weise auch in ihrer heutigen Ausbreitung gültig geblieben. Versuche
eigenwilliger Bauherren, dieses Gesetz zu missachten, sind Ausnahmen geblieben,
wie sie etwa die Gassenform der Calle Londres bei der roten San Francisco-Kirche
darstellt.
Neben dieser Zweitältesten Kirche (älter noch ist die kleine Kapelle an der
Avda. Independencia) weist unsere Landeshauptstadt nur wenige Baulichkeiten
aus der Kolonialzeit a u f : da ist vor allem das schlichte, aber deshalb nicht weniger
imposante Regierungsgebäude MONEDA zu nennen, das einst — wie der Name
61
sagt — zur Münzenprägung bestimmt, einem Irrtum zu verdanken ist, denn dieser
Monumentalbau war von der spanischen Krone f ü r Mexico gedacht und ist nur
deshalb hier errichtet worden, weil die dazu gehörigen Baupläne nicht ihren Bestimmungsort, sondern Santiago de Chile, erreichten. Heute strahlt der Bau der
Moneda, eingefasst von einer langen Reihe von Hochhäusern, auf freiem Platze
liegend, eine Athmosphäre althergebrachter Rechtschaffenheit und ernsten Strebens aus.
Die "Posada del Corregidor" — heute Heim des chilenischen Schriftstellerverbandes, die "Casa Colorada" in der Calle Merced und das eher hässliche, als
altertümliche Postgebäude, einst Regierungsgebäude in der Kolonialzeit, sind die
wenigen hervorragenden Baulichkeiten, die Santiago aus dem 16. und 17. Jahrhundert noch geblieben.
Aber auch die beginnende Republik weist in dieser Sicht nicht viele eigene
Schöpfungen auf, es sei denn die lange Reihe von Denkmälern der Nationalhelden,
die als Reiterstatuen längs der Alameda errichtet, den Eindruck eines kriegerischen Volkes hinterlassen. Und dennoch sind gerade in jener Epoche die Grundpfeiler eigenen nationalen Werdens errichtet worden und haben in ihren Bauten
einem neuen Wollen Ausdruck gegeben: die Staatsuniversität, das von Rudolph
Amandus Philippi gegründete Naturwissenschaftliche Museum in der "Quinta
Normal", der "Palacio de Bellas Artes" am "Parque Forestal", die alte Militärschule am "Parque Cousiño", das Stadttheater, um n u r diese zu nennen. Dazu
entstanden, in Anlehnung an die Grosszügigkeit des einst von Napoleon gestalteten Pariser Stadtplanes, die eben genannten Parkanlagen, die ohne Zweifel ein
Schmuckstück der Landeshauptstadt sind, nicht zu vergessen die imposante Anlage der Pferderennbahn — Club Hípico genannt.
Santiago eigentümlich aber ist lediglich der Berg San Cristóbal mit dem grossen Standbild der Heiligen J u n g f r a u Maria, das schon oft als Wahrzeichen der
Stadt bezeichnet worden ist, jedoch nicht volkstümlich genug erscheint, um als
solches bewertet zu werden. Eigentümlich f ü r Santiago ist der "Cerro San Cristóbal" deshalb, weil nur wenige Städte der Welt einen so vorgelagerten Hügel der
Cordillerenkette umzingeln. Von hier oben, ist das Stadtbild in seiner ganzen
Grossartigkeit zu erblicken. Das Auge reicht kaum, um das Häusermeer nach allen
Richtungen hin zu erfassen. Von hier oben sieht man den Schmutz des "Mapocho",
sieht man den Dreck der unwürdigen Behausungen der Armenviertel am Stadtrande nicht mehr. Den Schmutz sieht der Santiaguiner aus der Gewöhnung ohnehin nicht und erspäht ihn eigentlich nur, wenn er von einer Europa- oder USAReise in die heimatliche Stadt zurückkehrt und Unterschiede zu beurteilen vermag.
Aber vom Gipfel des Berges mit dem bezeichnenden Namen des Heiligen
Christoph, der die Wahrheit über den Strom der Würde- und Glaubenlosigkeit
rettete — vom Gipfel des "San Cristóbal" aus weiss man nicht, was schöner ist:
Der Blick am Tage, wenn Stadt und Land in der Sonne liegen, von der majestätischen Andenkette eingerahmt, oder das Bild der Nacht, wenn die vieltausend flimmernden Lichter zwischen Hochkordillere und Küstengebirge fast unmerklich zusammenfliessen mit den ruhigen Lichtern des Himmels zu Bild und Gleichnis von
Zeit und Ewigkeit.
62
D*. JUAN WESTERMEYER — Santiago
Kann und darf der chilenische Akademiker seinen
deutschen Kern hüten und wahren?
Unter würdigen Geschäftsleuten besteht in Reklamesachen der Grundsatz:
Du darfst Deine Ware in den höchsten Tönen anpreisen, doch ist es nicht s t a t t haft, die der Konkurrenz in ihrem Werte herabzumindern. Dieses sehr weise P r i n zip stelle ich an den Kopf meiner kurzen Überlegungen.
Die Bedeutung der mit dem Titel aufgeworfenen Frage wird uns erst klar,
wenn wir uns vor Augen halten, dass wir jeweils, das heisst von einer geschichtlichen Etappe zur anderen, zu entscheiden haben, ob wir hier im fernen und einzigartigen Chile das Recht haben, uns als deutsche Menschen behaupten zu wollen, und ob sich der grosse Verschleiss an Energie und Geldmitteln und die vielerlei Unbilden im häuslichen Leben, die zur Erreichung des zu diskutierenden Zieles verwandt werden müssen, für eine Zukunftsspanne von etwa einem Menschenleben lohnen. Denn es ist doch so, dasß der Aufwand an ständigem Einsatz jeden
angeht, der zur Wahrung einer geistigen und sprachlichen deutschen Integrität
seine ganze persönliche Disziplin in die Wagschale werfen muss, um die immer
kräftiger werdenden Einflüsse einer äusserst gefälligen und wohlwollenden U m welt auszugleichen. Das Geld haben stets kleine Gruppen oder am Objekt interessierte kulturelle Zentren aufzubringen, und ein gewisses Unbehagen macht jeder
Erzieher durch, der in seinem häuslichen Kreise versucht, die Pflege einer sauberen und mehr oder weniger vollkommenen zweiten Sprache aufrecht zu erhalten.
Als erstes gestatten Sie mir darüber nachzudenken, ob es überhaupt einen
deutschen Menschen als Naturerscheinung, als Eigenart und als Typus schlechthin gibt.
Hierzu zunächst eine Aussage Heinrich Barnkamms: „Und der Mensch ist
immer bestimmte jeweils besondere Person. Gewiss ist ihm ein allgemeines Wesen eigen, das ihn über alle Unterschiede der Völker und Zeiten hinweg zum Menschen macht. Aber es verwirklicht sich immer nur in Individuen und den ihnen
allein zugehörigen Gedanken, Empfindungen und Handlungen. An der Individualität des Menschen hat die Verwurzelung in ¡seinem Volke entscheidenden Anteil!" Dass dem so ist, müssen wir alle anerkennen, jedoch jene Nuancierungen
mit in Betracht ziehen, die aus der geschichtlichen Stunde und gewissen ethnologischen Gesamtgegebenheiten entstehen. Es ist auch ganz gewiss so, dass je
63
fester eine Persönlichkeit aufwächst, um so mehr sich ihr sittliches Pflichtgefühl entwickelt.
Ein deutsches Volksbewusstsein hat es nicht von Urzeiten an gegeben. Es hat
sich allmählich, oft durch schwere Kämpfe und Verluste, als geschichtliche und
geographische Erscheinung einer Menschengruppierung
herausgeschält. Sein
erstes Aufleuchten reicht wohl in die Zeit der Römer zurück, da sich die Germanen im Gegensatz zu jenen zum ersten Mal ihrer Eigenart bewusst geworden sind.
Gegen Ausgang des ersten Jahrtausends konnte durch das glanzvolle Auftreten
der Sachsen und Franken im Deutschen Kaisertum, von Heinrich I. an, das deutsche Bewusstsein endgültig gekräftigt werden. Hier und später schälen sich symbolhafte Gestalten aus der Vorzeit heraus, die als bleibende Beispiele und W e g weiser in Wort und Reim erhalten geblieben sind. Ich erinnere dabei an den Cheruskerfürsten Armin und an die vielen Sagengestalten, die in der Dichtung der
Stauferzeit, im Deutschlandlied Walters von der Vogelweide, in Heldenepen und
Volksmärchen f ü r immer ihren Ausdruck fanden. Das eigentliche Volkstum löste
sich später vom zu universell eingestellten Kaisertume und kam erst richtig im
ausgehenden Mittelalter zum Zuge, so z. B. als Unternehmen wie die Ostkolonisierung durch die Hanse zum Aufblühen der Reichsfürsten führte. Die Kraft und
die Unterlage gab von nun an das ständisch aufgebaute Stammesreich und das,
was man unter Vaterlandsgefühl versteht, entstand erst später im deutschen
Humanismus im Wettstreit mit einem ähnlichen Aufblühen in Italien. Weiterhin
wurde Martin Luthers sprachliches und allgemein menschliches Auftreten entscheidend, so dass von nun an mit Recht von einer mehr oder weniger abgerundeten Stammes- und Spracheinheit die Rede sein konnte.
Im Laufe der Zeiten wird dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit immer
augenfälliger, vor allem deshalb, weil diese aus vielen Landsmannschaften bestehende Volksgruppe im Widerstreit mit den sie umgebenden Nachbarn durch gemeinsame Not, durch Leiden aller Art, spartanische Sparsamkeit, Kriege und
bittere Irrungen zu einem festen Konglomerat zusammengeschweisst wird. Die
anfänglich friedliche Durchdringung der europäischen Ostgebiete
und die um
1840 einsetzende Auswanderung nach Übersee sind die Folgen eines immer spürbarer werdenden Raummangels, da man ja noch nicht wie in heutigen Tagen
verstand, auf kleinster Fläche zu wirtschaften. Solchermassen, im Zuge dieser
Entwicklung, kam es dann auch zur Verwurzelung des deutschen Menschen im
südamerikanischen Raum, ein Umstand, der uns ja besonders angeht.
Die f ü r einen Teil der Europadeutschen sehr glückliche Wendung des letzten
Jahrzehnts lässt erkennen, wie ein wieder aufblühendes Land nun in die Lage
kommt, seine reichen Kulturschätze an die übrige Welt zu verschenken und. mit
allen Mitteln f ü r deren Verständnis zu werben. Nach den traurigen Tagen der
Unsicherheit und des Zweifels sehen wir darin wieder einen Lichtblick und einen
Halt, den die kleine nach Chile versprengte Gruppe äusserst nötig hatte. Vom
Brot allein lebt eben der Mensch nicht, er braucht geistige Kräfte, die ihn aufrichten, anspornen und von innen heraus tragen.
Wie ist es nun um diesen deutschen Menschen bestellt?
Über die Völker der Welt bestehen natürlich die verschiedensten Meinungen
und Urteile, zumal wir auf diesem Gebiete eines allgemeingültigen Masstabes er64
mangeln und in jedem Konglomerat individuelle Abstufungen sehen, die den
Überblick trüben. Jedenfalls ist es so, dass keines so schlecht ist, dass es als
menschenunwürdig angeprangert werden könnte und keines so gut, um der Welt
als unumstrittenes hehres Beispiel vor Augen geführt zu werden. Wenn wir hier
das deutsche Volk in besserem Lichte sehen als es irgendeine internationale Einrichtung tun würde, so möge .solches die Liebe und Zuneigung rechtfertigen, die
jeder rechtschaffene Mensch seinem Stamme entgegenbringt.
Diese allgemein
als loyal angesehene Haltung entwächst ausserdem tieferen göttlichen und biologischen Wurzeln, die uns nicht immer klar zum Bewusstsein kommen.
Man spricht in der zweiter Hälfte des XX. Jahrhunderts nicht gern von Tugenden und überlässt solches vielmehr den Lehrern, Priestern und Pastoren. Heute
fordert man vom Manne eher, dass er schlau, gerissen, wendig, draufgängerisch,
wenn nicht gar brutal ist, Wir glauben, dass die grosse Masse des deutschen Volkes die klassischen Tugenden in hohem Masse besitzt. Da haben wir auf einer
Seite die Tugenden, die das Individuum auszeichnen: Tapferkeit, Wahrhaftigkeit,
Beharrlichkeit, Geduld (wohl auch als weibliche Tapferkeit zu deuten), Gelassenheit, Besonnenheit. Wetteifer, Ehrtrieb, Bescheidenheit, Gewöhnung an tüchtige Arbeitsleistung, Freude am Sport, Spiel und Kunst um ihrer selbst willen;
aui der anderen die sozialen: das Wohlwollen in allen seinen Formen, vor allem
im Sinne der Gerechtigkeit in Familie, Geselligkeit und wirtschaftlicher, staatlicher oder religiöser Gemeinschaft. Wer beweist mir mit unleugbaren Tatsachen,
dass der Deutsche nicht einen hervorragenden Anteil an der Pflege und am Weiterbestand dieser unbestreitbaren Lichtseiten der menschlichen Person besitzt?
Die Sprache ist lebendiger Widerschein der deutschen Volksmoral geworden
und zwar nicht nur durch das, was sie den Werken der Dichter und Bibelübersetzer entnommen hat, sondern auch durch all das, was als volksmundliche Überlieferung erhalten geblieben ist. Wer kennt nicht diese und andere geflügelte
Worte, die tiefer wirken als nüchterne Paragraphen des Gesetzes: „Hochmut
kommt vor dem Fall. Lügen haben kurze Beine. Ehrlich währt am längsten. Unrecht Gut gedeiht nicht. Wer den Groschen nicht ehrt, ist des Talers nicht wert."
Die ersten in meiner Erinnerung bewusst gebliebenen Jahre verbrachten wir
Kinder unter der Betreuung der Grossmutter. Morgens vor dem Schulgang holte
sie uns mit folgenden Worten aus dem Bett: „Auf, auf! so sprach der Fuchs zum
Hasen. Hörst Du nicht die Trompeten blasen?" Dieses nichtssagende, vielleicht
aus hessischem Volksgut stammende Verschen ist f ü r mich der Inbegriff alles
Pflichtbewusstsein und der Überwindung unserer menschlichen Schwächen geworden.
Welches Volk darf sich rühmen, keine negativen Phasen in seiner Entwicklung durchgemacht zu haben? Nur wenn solche Wellentäler zu lang währen,
wenn sie keine wahre reuevolle Besinnung auslösen und der innere Aufschwung
fernbleibt, könnte man innerhalb des grossen Weltgeschehens von Zeichen des
Unterganges oder der Verantwortungslosigkeit sprechen.
Sprache und Schrift, oberster Ausdruck, Träger und Vermittler eines Volksbewusstseins, verdienen eine gesonderte Betrachtung. Nur wenige werden mit
Nietzsche übereinstimmen, der behauptet, dass unter lateinischen Menschen die
deutsche Sprache „immer sehr roh, wälderhaft, heiser, wie aus rauchigen Stuben
65
und unhöflicher Gegend stammend" wirkt. Ja, sie ist anders, aber sie kann Sachen sagen und geistige Disziplinen vermitteln, wie keine andere.
Sprache und Stammesanlage bilden eine natürliche und gewachsene Einheit,
die wohl gesprengt werden kann, die aber in ihrem harmonischen, sich gegenseitig befruchtenden Zusammenspiel die schönsten Früchte trägt.
Hier möchte ich einige Sätze aus den merkwürdigen Betrachtungen wiedergeben, die Wilhelm von Humboldt, der ältere Bruder Alexanders, in seiner „Lehre
von der Sprache als geistige Kraft der Völker" niedergeschrieben hat, wobei hervorzuheben ist, dass der Autor seine Erfahrungen an eigenen und fremden Kindern anlässlich eines mehrjährigen Aufenthaltes in Spanien und Frankreich
machte.
Nachdem er eingangs hervorhebt, dass die Zivilisation und Kultur die grellen
Kontraste der Völker allmählich aufheben, was uns heute nach 150 Jahren i m mer deutlicher wird, können wir folgendes lesen: „Man könnte einwenden wollen,
dass die Kinder jedes Volkes, ehe sie sprechen, unter jedes fremde versetzt, ihr
Sprachvermögen an dessen Sprache entwickeln. Die unleugbare Tatsache, könnte
man sagen, beweist deutlich, dass die Sprache bloss ein Wiedergeben des Gehörten ist und ohne Rücksicht auf Einheit oder Verschiedenheit des Wesens, allein
vom geselligen Umgang abhängt. Man hat aber schwerlich in Fällen dieser Art
mit hinlänglicher Genauigkeit bemerken können, mit welcher Schwierigkeit die
Stammesanlagc hat überwunden werden müssen, und wie sie vielleicht in den
feinsten Spielarten unbesiegt zurückgeblieben ist." Und an anderer Stelle: „Da
auch auf die Sprache in derselben Natur eine gleichartige Subjektivität einwirkt,
so liegt in jeder Sprache eine eigentümliche Weltansicht."
Um das Bild abzurunden, durch welches man den deutschen Menschen in
Schlaglichtern darstellen könnte, möchte ich noch an Ortega y Gasset erinnern,
der jenen mit dem Lateiner folgendermassen vergleicht: Der Deutsche ist in einem. Zimmer geboren, fühlt sich darin sehr wohl und geht n u r hin und wieder
aus diesem Raum hinaus. Der Spanier hingegen ist auf der Plaza geboren; die
Volksmenge, die Strasse und der grosse Ballsaal sind sein Zuhause. Diese meisterhafte und anschauliche Skizzierung, die ich aus dem Gedächtnis niederschreibe, ist mir ein Beweis dafür, dass beide Arten, wo immer sie zusammentreffen,
sich bestens ergänzen und vertiefen. So ist zum Beispiel nicht von der Hand zu
weisen, dass die Prägung, die Chile von Seiten der zentral- und nordeuropäischen
Länder erfahren hat, die soziale und politische Ausgeglichenheit mitbewirkt haben kann, die unser Land im südamerikanischen Konzert auszeichnet.
Zum Schluss dieses Abschnittes sei noch die vielumstrittene Frage gestreift,
wie weit sich das menschliche Wesen als Ganzes genommen, von seiner Umgebung beeinflussen lässt, sich verändert und diese neuerworbenen Eigenschaften
auf kommende Generationen übertragen kann. Die Beobachtungen vieler auf
diesem Gebiete lassen sich etwa wie folgt zusammenfassen: ,a) Die Beeinflussbar keit des Einzelnen durch Erziehuhg und Umgebung ist vorhanden und individuell
verschieden, b) Je jünger und daher plastischer der Mensch ist, um so mehr ist
er zu beeinflussen, c) Ein Kern jedoch, nämlich das Produkt unseres innersten
Erbgutes, bleibt unwandelbar bestehen: auf ihm wachsen als Zusatz unsere äusseren Variationen, Gebärden, Trachten, gesellschaftliche Formen, d. h. Sitten
66
und Gebräuche, d) Mit zunehmendem Alter tritt der Kern mehr und mehr durch
jeden äusseren Firnis hindurch. Wir werden wieder natürlich wie das Kind, und
wenn wir einen Gutteil deutscher Introversion in uns haben, sind wir dann auch
gern mal ein bisschen allein, e) Der östliche wie der westliche Materialismus,
beide gleich schädlich f ü r die Zukunft der Menschheit, neigen fraglos zur Nivellierung, der sich, nur selbstbewusste und gesunde Volksgruppen entgegenstemmen können.
Es gibt keine Naturerscheinung, die man hierzu vergleichsweise heranziehen
könnte, denn wiewohl wir den Fortbestand unserer äusseren Formen augenscheinlich von Generation zu Generation verfolgen können, ist unser geistig-seelisches Problem schwerer zu überblicken: Was ist neu? Was ist unmittelbar e r erbt? Was steigt schliesslich nach vielen Menschenaltern des Schweigens aus dem
Urgrund unserer geistigen Erbmasse empor?
Lassen wir es mit diesen teils leichten, teils schweren Kostproben bewenden.
Sie sollen nur ein mosaikhaftes Bild des deutschen Menschen und seines möglichen Weiterbestandes vermitteln.
Im letzten Abschnitt liegt uns daran, eine Aussage über den Akademiker zu
machen.
Der Studierte von heute ist nicht mehr das, was er vor 50 oder 100 Jahren
war, da das moderne Leben ihn vielerorts seiner Würde entkleidet hat. Schuld
daran sind unter anderem die Massenausbildung und die Entstehung eines geistigen Proletariats, die den menschlichen Qualitätsdurchschnitt stark nach unten
verschoben und ihm den weitausstrahlenden Einfluss von f r ü h e r genommen h a ben. Nur- wer durch die Verbindung mit der Wirtschaft, durch ausserordentliches Fachkönnen oder Besetzung der relativ wenigen hohen Stellen der Universitäts-Einrichtungen glänzen kann, entgeht diesem Schicksal der Norm. Trotzalledem stellt auch der Akademiker von heute eine Auslese jener Menschen dar, die
durch in der Wissenschaft geprägte Methodik und Denkungsart einen grösseren
und objektiveren Überblick gewonnen haben und damit die Berufung übernehmen, in ihren privaten und beruflichen Kreisen Richtlinien aufzusetzen, wenn nicht
immer mit dem Wort, so doch mit dem Beispiel.
Die heutige Stellung der chilenischen Studierten deutscher Herkunft beweist,
dass die bewusste Bewahrung der Art, durch von Generation auf Generation
übertragene Tradition, ein durchaus zu bejahender Weg gewesen ist. An der
kritischen Beobachtung seiner Altvordern und an sich selbst erkennt er die a u s serordentlichen Vorteile einer Sonderstellung, die ihm das Schicksal zugewiesen
hat. Der Besitz zweier Sprachen vertieft seine Persönlichkeit in hohem
Grade auch wenn das Deutsche zweite Sprache ist, so bleibt es stets mehr als
nur erlernte Fremdsprache. Die dialektische und menschliche Brücke, die er zum
Europadeutschen schlägt, macht ihn f ü r beide Ufer zu einem unentbehrlichen
Vermittler in schweren und guten Zeiten. Die einmalige Hilfestellung, die er in
wissenschaftlichen Instituten lateinischer Prägung leisten kann, hilft die unendlichen Schwierigkeiten hinwegräumen, die der Nichtgermanist auf Schritt und
Tritt in deutschsprachiger Literatur antrifft. Sein immerwährender Kontakt mit
dem deutschen Sprachtum erschliesst ihm endlich eine Geisteswelt, die ihresgleichen sucht, deren Hauptkennzeichen die Wahrheitstreue, die Nüchternheit,
67
die Klarheit und die Knappheit sind. Unmerklich fliesst der alte humanistische
Geist ein, der ihn auf der einen Seite fest auf dieser Erde wandeln lässt und ihm
auf der anderen die grosse Liebe zur Religion, Kunst oder N a t u r aufschliesst.
Eine unserer beachtenswertesten
Eigenschaften, die ich nicht unerwähnt
lassen möchte, ist die des 'Führens und Gehorchens, die wir im gleichen Grade
wohl gepaart besitzen. Das allzugerne Gehorchenwollen wird uns wohl oft zum
Vorwurf gemacht, ist aber eines der Fundamente des steten Wiederaufstiegs des
deutschen Menschen, es ist der bleierne Fuss des Stehaufmännchens. Eine Nation
kann eben nur neben 907c Untergeordneten 10% Führende haben, wobei erstere
ihre tägliche Zahnrädchenleistung mit derselben Freude und innerer Genugtuung vollbringen müssen, die auch die wenigen erfüllt, die das Geschick in leitende Stellungen erhaben hat.
Wenn wir schliesslich noch hinzufügen, wie die Bipolarität unserer Sprachen
in ähnlichem Masse eine Bipolarität im charakterlichen zum Gefolge hat, sehen
wir, dass wir in einem mehrschichtigen Kräftefeld wirken können, das uns u n endliche Vorteile hietet. Und nicht von der Hand zu weisen ist der Umstand des
kleinen Widerstandes, den .wir nun mal, so wie wir sind, in unserer Umgebung
auslösen, ohne jeden zehnten seinen Gevatter oder "compadre" oder jeden dritten
unseren Verwandten oder "amigo" nennen zu können, und der uns zu einem
dauernden Ansporn im offenen und fairen Konkurrenzkampf um unsere Position
wiro.
Der Herrgott hat es sc gefügt und die Naturwissenschaftler haben es in allen
Einzelheiten festgelegt, dass sich die Spezies Mensch in beliebigem Wechselspiel
ungeachtet der Grösse, der Farben, der Formen und der Charaktere begatten
und fortpflanzen kann. Dieses heisst auf Jahrhunderte hin gesehen, dass bei genügender Durchschüttelung, wie diese die fortschrittliche Technik weitestgehend
begünstigt, eine einheitliche Mischbevölkerung diesen Erdball bewohnen wird.
Im Augenblick jedoch befinden wir uns weit entfernt von diesem alles nivellierenden Endstadium und wir erleben, wie nach Mendelschen und anderen
Gesetzen die Vermischungen so vor sich gehen, wie es das Zusammenleben der
Menschen mit sich bringt. Der lokale Unterschied wird augenfällig, wenn wir
Gegenden wie Deutschland, SüdtiroJ oder Chile einander gegenüberstellen: hier
vollführt sich das Phänomen im Kräftefeld der jeweils waltenden physischen und geistigen Faktoren Und da tritt nun der Mensch in seiner Sondereigenschaft als denkendes und führendes Wesen auf den Plan und trifft
Entscheidungen
die in jahrhundertealter Tradition aus dem Blute hervordrängen oder den tiefen Eindrücken des Milieus nachgeben. Hier kämpfen um den
Preis Familie und Elternhaus auf einer Seite, Beruf und Strasse auf der anderen.
Mir fallen dazu die Worte ein, die F. K. Saelzer f ü r den deutschen Menschen
anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Deutschen Schule in Valdivia aussprach
und die ich in der Übersetzung wiedergebe: „Es ist kein würdiger Mensch, der
sein Etfbe verleumdet, und man fordere von uns nicht, wie m a n es auch von keinem Spanier oder anderen gefordert hat, dass wir künstlich beschleunigen, was
68
langsame!, natürlicher und organischer Prozess der Durchdringung sein soll".
Und erwidert auf gewisse Vorwürfe mit dem Satze Ramiro de Maeztus: „Sein
und die K r a f t zu sein sind eiraes, und ein anderer sein wollen, heisst aufhören zu
sein. Um unsere Person zu kräftigen, darf man nicht anders sein wollen, sondern
muss das eigene Sein steigern."
Zusammenfassend dürfen wir vielleicht so sagen: Es gibt einen deutschen
Menschen, der heute in seinem Ursprungsland, in Grenzgebieten und weitverstreut in der übrigen Welt lebt. Im Laufe von etwa 1000 Jahren Geschichte hat
er körperliche und geistige Sonderheiten entwickelt, an denen viele von uns mit
Stolz und Bewusstsein teilhaben. Die Sprache und die Schrift erweisen sieh als
die wichtigsten Werkzeuge unserer Arterhaltung und müssen unermüdlich gefördert werden. Die deutsche Gemeinschaft Chiles ist sich ihrer Aufgabe bewusst,
Ergänzung und Vertiefung in vieler Hinsicht zu sein, wo sie mit ständig erneuter Begeisterung ihre positiven K r ä f t e zum Wohle des Ganzen ansetzt. Dem Akademiker unter uns ist durch klare Einsicht dieser Dinge die Aufgabe gestellt,
unsere Gruppe zu festigen und zu schliessen, um kraftvoll und -gestärkt f ü r dieses unser Vaterland einzutreten. Diie Entwicklung des Konglomerats der Vereinigten Nationen von Nordamerika und in anderen Ländern scheint zu zeigen,
dasi die Volkstumsgruppen mehr Kraft und Fähigkeit entwickeln als die wahllose Vermengung. Chile hat den Deutschen f ü r immer auf seinem Boden aufgenommen und dieser gab und gibt mit vieler Liebe alles, was er hat.
Als die anfängliche Emanzipation Südamerikas zum Stocken kam, war es
Alexander von Humboldt, der den grossen Simón Bolívar, damals noch Jüngling,
anfeuerte, f ü r diesen weiten, herrlichen und zukunftsschwangeren Kontinent
einzutreten. Seien wir die ständigen Erben dieses weitsichtigen und einzigartigen
Deutschen.
69
ROBERT DICK — FrutiUar
Warum Gewerbeschule im Süden Chiles?
Dass im chilenischen Schulwesen, trotz des guten Willens der Regierung,
noch immer sehr viel im Argen liegt, ist bekannt. Wie katastrophal zum Teil j e doch die Zustände noch sind, erläuterte durch Angaben und Zahlen der Superintendent des Erziehhungswesens kuerzlich in seinem anlässlich der Tagung des
Deutsch-Chilenischen Bundes in Santiago gehaltenen Vortrag: Etwa 40% aller
Schueler kommt nicht viel mehr als ueber die 2. Vorschulklasse hinaus und fällt
damit in ein Analphabetentum zurueck. Von den Zöglingen der Höheren Schulen
(Lyzeen, Handelsschulen usw.) erreichen nur rund 84% die mittlere Reife (und die
nur unter Anstrengung und Wiederholung des J a h r e s ) ; von den restlichen 16%,
die den zweiten Zyklus besuchen, werden nur 1,4% an den Universitäten zugelassen. Wohin ergiesst sich nun der gewaltige Strom der schulentlassenen und oft
noch minderjährigen Jugend? Was können wir tun, um auch diese jungen Menschen sinnvoll weiterzubilden und sie als nuetzliche Glieder in den Arbeitsprozess
der Gemeinschaft einzugliedern? Wie begegnen wir dieser allgemeinen „Flucht"
aus der Schule?
Ein Versuch zur Lösung der schwebenden Fragen ist der sogenannte „AricaPlan": Alle Schueler, die im ersten, zweiten oder dritten Oberschuljahr versagt
haben oder deren Weiterstudium aus irgendeinem anderen Grunde problematisch
erscheint, sollen in besonderen Schulen, den sog. "Colegios Medios" zusammengefasst werden, wo ihnen neben wenigen theoretischen Kenntnissen
(nur eine
Fremdsprache, Buchführung und Maschinenschreiben) vor allem praktische Fertigkeiten durch Arbeiten als Mechaniker, Installateure, Schreiner, Elektrotechniker
und Klempner vermittelt werden. Die Fachleute im Erziehungsministerium haben
sich mit Recht gesagt: Mit dem Hinweis auf die sogenannte Allgemeinbildung können wir den jungen Menschen nicht mehr ansprechen. E r ist der Schule und ihres
toten Stoffes muede. Er weiss, dass seine geistigen Fähigkeiten oder seine Geldmittel f u e r ein langes Studium nicht ausreichen. Der Kampf ums tägliche Brot
zwingt ihn zum baldigen Eintritt ins Berufsleben. Und da in Chile ueberall Handwerker fehlen, so gilt es, zuerst diese fuehlbare Luecke zu schliessen. Das Handwerk hat auch heute noch in Chile einen goldenen Boden! . . . .
Was hier in wenigen Sätzen allgemein gesagt wurde, hat seine besondere und
verstärkte Geltung f u e r den Sueden unseres Landes, nicht zuletzt auch f u e r die
deutschstämmige Bevölkerung. E s sei im Folgenden versucht, aufzuzeigen, welche
Gruende dafuer sprechen, im . S u e d e n Chiles eine Handwerker schule mit deutschen Lehrkräften zu errichten:
70
a) Das Bestehen guter Auffangschulen im Norden.
Es ist die entlegene, f a s t tausend km von der Hauptstadt entfernte Provinz,
in die der allgemeine Fortschritt zuletzt und manchmal zu spät kommt. In Valparaiso besteht eine ausgezeichnete Technische Universität, die "Santa Maria". In
der Hauptstadt bietet ein vielfach gegabeltes und wohlausgebautes Schulwesen
Möglichkeiten der Weiterbildung. So erstrebenswert auch dort die Errichtung einer Gewerbeschule nach deutschem Muster wäre, im Süden ist sie dringlicher.
b) Technisierung der Landwirtschaft
Die Landwirtschaft hat im Sueden in den letzten 10 Jahren einen ungeahnten
Aufschwung genommen. Fast alle Betriebe sind weitgehend motorisiert und mechanisiert, was man von der Landwirtschaft 'Mittel-Chiles nicht in diesem Masse behaupten kann. Als Gruende hiefuer mögen die allgemeine Entwicklung, Arbeitsersparnis, höhere Rentabilität, Unzuverlässigkeit vieler einheimischer Landarbeiter, hohe Soziallasten, grosse Nutzflächen, z. Teil unguenstiges Klima (man muss
„schnell" ernten können) und die weiten Entfernungen angegeben werden. So
sind im Laufe der letzten J a h r e besonders bei der deutschstämmigen Landbevölkerung technische Einrichtungen entstanden, die man f r u e h e r nicht kannte: Mähdrescher, Traktoren, Heupressen, Wegebaumaschinen, Autos und Lastwagen in
grosser Zahl, elektrische Pumpen und Melkanlagen usw. Meist verfuegt der Besitzer dieser Maschinen n u r ueber eine oberflächliche Kenntnis seiner mechanischen Helfer, die sich auf Pflege und Wartung 'beschränkt; ein Verständnis der
Funktionsweise und damit die Möglichkeit der Reparatur aus eigener Kraft ist
nur in Ausnahmefällen vorhanden, Wie schmerzhaft ist es für den Landwirt,
wenn ausgerechnet während der Erntezeit der Mähdrescher anfängt zu „hunzen",
wie man hierorts bezeichnenderweise die Motorpannen umschreibt! Wie so m a n cher musste sich halt noch einmal 4 Wochen gedulden, bis sein Auto (schlecht!)
repariert aus der Garage kam! Der Mangel an Facharbeitern ist eben zu gross!
c) Es gibt kaum noch urbares Neuland.
E s ist eine unbestreitbare Tatsache, dass auch im Sueden das anbaufähige
Landi immer knapper und teurer wird. 1 ha guter Boden (kostet etwa E'' 500,—.
Weitschauende Landwirte haben bereits angefangen in Chaitön, am ¡Lago Rosselot, am Yelcho und im Alto Palena f u e r ihre Kinder Land zu erwerben, bzw. zu
kolonisieren. Zwischen vielen Siedlungsplätzen besteht nur Flugverbindung, und
die Schwierigkeiten der Bewirtschaftung und Lebenshaltung sind enorm. Aber in
nicht allzuferner Zukunft werden auch die letzten Möglichkeiten der Landgewinnung erschöpft sein, und neue Wege der Betätigung gesucht werden müssen. Auch
hier bietet sich der Beruf des tuechtigen Handwerkers als Ausweg an.
d) Ausbreitung der Industrie.
Die Industrialisierung des Suedens ist sehr stark vorangetrieben worden: Die
grosse Zuckerfabrik "IANSA" in Llanquihue, NESTLE's Milcherzeugnisse: "CHIPRODAL" in Osorno und Llanquihue, "LECHERA DEL SUR" mit mehreren
71
Zweigstellen, Kartoffelmehl-, Bier-, Hefe-, Wurst-, Papier-, Schuh- und Zellulosefabriken sind entstanden. Auch da fehlen ueberall die Facharbeiter.
e) Wohnungsbau.
Nach dem Erdbeben hat eine fieberhafte Bautätigkeit eingesetzt, die durch das
grosszügige W o h n u n g s b a u p r o g r a m m der Regierung noch lange anhalten wird,
denn bei Chiles gewaltigem Bevölkerungswachstum wird das Wohnungs-Defizit
noch lange erhalten bleiben. Ein unbeschreiblicher Mangel an Handwerkern, vor
allem Spenglern, Installateuren, Bau- und Möbelschreinern macht sich von Tag
zu Tag deutlicher spuerbar.
f) Psychologische Überlegungen,
Neben diesen — mehr oder weniger — vom reinen Nützlichkeitsdenken diktierten Gruenden, die f u e r eine Errichtung der Gewerbeschule im Sueden sprechen, bestehen auch noch seelische und erzieherische:
In einer vom Technischen bestimmten Welt verliert der Mensch gar bald den
Sinn f u e r das Geschaffene. Die Dinge kommen fertig aus der Maschine; aber gerade dadurch verlieren sie ihren Wert. Sie sind billig und leicht ersetzlich. Eine Zeitlang sah es so aus, als brächte die Maschine das Handwerk zum Sterben. Aber
gerade im uebertechnisierten Nordamerika wurde die Handarbeit eingesetzt als
Gegenkraft gegen abstumpfende Arbeit an der Maschine. In den Gefängnisanstalten gelingt es am leichtesten, den Sträfling durch Arbeit seiner Hände in die verloren gegangene Gemeinschaft wieder einzugliedern. Die Kriegsgefangenen bezeugen uebereinstimmend, dass es f u e r sie keine schrecklichere Zeit gab, als die
des unfreiwilligen Muessigganges. Aus diesen wenigen Beispielen leuchtet der
Wert der Handarbeit als Erziehungsmittel. Und brauchen wir dieses Erziehungsmittel nicht gerade ganz besonders im Sueden, auch bei unserer deutschstämmigen Jugend? Werden die Erzählungen von der harten Arbeit des Bodens .und
Urbarmachens ihrer Vorfahren nicht oft als ein Kindermärchen angesehen, das
man nicht mehr ernst zu nehmen braucht? Wie viele junge Menschen pochen auf
ihren Geld- und Grundbesitz und verlieren ihre Zeit in Spelunken und Kantinen!
In törichter Verblendung verschliessen sie sich vor der allgemeinen Not und sind
die trefflichsten Wegbereiter des Kommunismus!
Eine wohlausgebaute Gewerbeschule, die neben der praktisch-theoretischen
Ausbildung auch an die sittlich-religiöse Unterweisung denkt, wird auch in diesem Sinne aufbauend wirken können, wenn sie a u s dem Sumpf einer oft beobachteten Tatenlosigkeit hinfuehrt zu geregelter und sinnvoller Arbeit. So wird die
Gewerbeschule ein Mittel sein, unsere gefährdete Jugend im Sueden Chiles vor
einem falsch verstandenen „Junker- und Halbstarkentum" zu bewahren und sie
einzureihen in die altbewährten Bindungen der Familie, der Heimat und der Religion.
Dass der Jubilar, dem diese Zeilen in herzlicher Ergebenheit gewidmet sind,
den Bau einer Gewerbeschule auch von dieser Seite her gesehen hat, verpflichtet
uns zu besonderem Dank.
72
Di STEWART W HERMAN — New York
Boden und Saat
(Das Evangelium unserer lutherischen Kirche in Lateinamerika)
Lateinamerika hat viele Aspekte für die verschiedensten Menschen. In kultureller und religiöser Hinsicht hat es grosse Ähnlichkeit mit dem Mutterland
Europa, besonders mit den Mittelmeerländern. In seinen politischen Idealen und
Bestrebungen — besonders im Drang nach persönlicher Freiheit und nationaler
Unabhängigkeit — steht es Nordamerika näher. Begrifismässig gehören beide
Teile Amerika's, sc wie es sich Washington und Simon Bolivat vorgestellt haben,
zusammen. Handelt es sich aber um wirtschaftliche und industrielle Merkmale,
sc hat das „unentwickelte" Lateinamerika viel mehr Gemeinsames mit den jüngeren Nationen in Asien und Afrika.
Je nach dem Gesichtspunkt des Betreffenden ist es möglich, den Photoapparat für Farbaufnahmen verschiedenartig einzustellen: Einesteils der ungeheure
Reichtum des Landes, das kulturelle Raffinement, die üppige tropische Schönheit,
dk tiefe Religiosität — oder aber am anderen Ende des Spektrums: Die schmutzige Armut, das weitverbreitete Analphabetentum, die ungastliche Wildnis und der
unerhörte Aberglaube! Die Wahrheit liegt wie üblich zwischen den beiden Extremen und schliesst beide mit ein: Gerade die Verbindung dieser krassen Gegensätze ergibt das charakterbildende Milieu dieser ganz besonderen Familiengruppc
det Völker in unserer Welt.
Und diese lateinamerikanische Familiengruppe wächst zusehends... schneller in der Tat ais irgendeine andere Gruppe! Sowohl die Hoffnung aber auch die
Verzweiflung der christlichen Welt sind mit dieser Tatsache verknüpft. Was für
ein Christentum — wenn überhaupt eines — wird Lateinamerika im Jahre 2000
aufweisen? Nach der gegenwärtigen Geburtenzunahme zu urteilen, wird sich
die Bevölkerung in 30 Jahren wieder verdoppeln... nicht infolge einer höheren
Geburtenzunahme, sondern dank der drastischen Mittel gegen die Kindersterblichkeit und Epidemien. Aus dieser Tatsache wachsen grosse Probleme f ü r die
lebenswichtigen Gebiete der Ernährung, der Wohnung und des Schulunterrichtes
der Bevölkerung. Aus guten statistischen Unterlagen ersehen wir, dass Lateinamerika gegenwärtig nicht Schritt halten kann im Blick auf das Wachstum
seiner Bevölkerung. Sollte aus diesem „Nicht-bewältigen" ein Chaos werden, so
würde das nicht nur f ü r die westliche Halbkugel, sondern f ü r die ganze Welt
ein Verhängnis sein.
73
Das Hauptproblem ist nicht — wie in gewissen Teilen Asiens — ein Mangel
an Lebensraum, sondern das Fehlen eines sozialen Ausgleichs. Es gibt genug
Lebensraum in den meisten der 20 unabhängigen Republiken (die etwa 190 Millionen Einwohner dieser Staaten verteilen sich auf ein grosses portugiesisch sprechendes Land: Brasilien und 18 spanisch sprechende — mit geringen sprachlichen Abweichungen untereinander — Länder. Die Sprachverständigung ist so
gross, dass nicht einmal die Republik im karibischen Meer, die sich der französischen Sprache bedient, oder die Länder mit stark holländischem oder englischem
Spracheinfluss irgendein Hindernis der Zusammengehörigkeit bilden.
Es ist sicher nicht übertrieben, wenn man behauptet, dass die Zukunft der
westlichen Hemissphäre als eines freien, gesunden, fortschrittlichen und zufriedenen Gebietes durchaus von einer intelligenten, erfinderischen Lösung der Lateinamerikanischen Wirtschafts- und Sozialprobleme,
die gemeinsam gefunden
werden muss, abhängt.
Viele der geistlichen Führer in Lateinamerika erkennen mit Schmerzen, wie
die revolutionäre Unruhe um sie herum wächst. Sie beobachten, wie die Produktion an Nahrungsmitteln im Verhältnis zur Bevölkerungszunahme in den letzten
Jahren um mindestens 6% zurückgegangen ist, dass nur 30% alles anbaufähigen
Landes — und von diesem befindet sich vieles auf grossen unrentabel bewirtschafteten Gütern — bestellt wird. Sie sehen mit Besorgnis, Wie die menschenunwürdigen Barackensiedlungen, wie ein „Krebs"-schaden wuchernd,
sich um
die grossen Städte ausbreiten. Sie wissen wohl, dass alles Mühen um Unterrichtsmöglichkeiten für die Millionen von Kindern so vergeblich ist und das Analphabetentum noch zu 30—60% in viel zu vielen Ländern vorhanden ist.
Was kann nun im Blick auf diese Lage die Aufgabe der Kirchen sein? Die
Protestanten neigen dazu, die Schuld an der 400-jährigen Versäumnis in der oben
beschriebenen sozialen Not der katholischen Kirche zuzuschreiben. Die Katholiken beklagen bitter alle Bemühungen der evangelischen Kirchen auf religiöser
und -sozialer Ebene als eine „Vernichtung von Katholiken, ohne das Christen
evangelischer Prägung gewonnen werden." Ein falscher Wettbewerb kann allerdings sehr teuer zu stehen kommen, denn das Ziel aller Bemühungen darf nicht
der Sieg einer Kirche über, die andere sein, sondern das Fortbestehen des christlichen Menschen.
Rein zahlenmässig kann die römisch-katholische Kirche heute noch auf mehr
als 90% der Bevölkerung in ganz Lateinamerika als -ihr zugehörig hinweisen. Das
sind ein Drittel aller Glieder der katholischen Kirche auf der Erde! Es würde
bald die Hälfte aller Glieder sein, falls Lateinamerika weiter eine führende Rolle
als „Überschussbevölkerung" spielt. So ist es nicht erstaunlich, wenn Lateinamerika — besonders in römisch-katholischen Kreisen — als das grosse Bollwerk
gegen den Kommunismus bezeichnet wird. Aber es wird von allen Seiten zugegeben, dass weniger als 10% dieser Glieder als „streng-katholisch" bezeichnet
werden können, selbst wenn diese etwa einmal im J a h r zur Kommunion gehen.
Antiklerikalismus und exotische Kulte afrikanischen Ursprungs
(um nur 2
Mächte zu nennen, die sich von der Kirche trennen) schaden der christlichen Einheit mindestens ebensoviel wie extremere Sekten des Protestantismus.
Der Vatikan hat offenbar gute Kenntnis von der Lage seiner Kirche und von
74
dei Notwendigkeit einer geistlichen Erneuerung und Verstärkung in Lateinamerika. Ein Rui nach 40.000 Priestern ist erlassen. Die lateinamerikanischen Bischöle haben in Bogotá eine Zentralstelle eröffnet, um ihre Bemühungen auf den Gebieten der Schulbildung, der sozialen Fürsorge und Seelsorge gemeinsam laufen
zu lassen. Wenn diese Bemühungen sich verstärken, kann die Wirkung auf die
protestantische Bewegung anders sein als die offenen Verfolgungen, die vor mehreren Jahren gegen evangelische Sekten in Kolumbien durchgeführt wurden.
Dessen müssen sich die evangelischen Kirchen aller Schattierungen bewusst sein.
Die ersten Samenkörner, die aus der Reformation des 16. Jahrhunderts reiften. wurden in Lateinamerika 2 Jahrhunderte völlig willkürlich hier und da ausgestreut Ers um die ¡Mitte des IS. Jahrhunderts konnten sie in Ländern, die kurz
vorher ihre Unabhängigkeil erkämpft hatten, Wurzeln schlagen. Die eigentliche
Missionsarbeit wurde grössten Teils von angelsächsischen Missionsgesellschaften
— getragen von Kirchen in Grossbritannien und Nordamerika — durchgeführt.
Nur ein geringer Erfolg war ihnen jahrzehntelang beschieden. Dagegen brachten
Tausende von Einwanderern ihren evangelisch-christlichen Glauben nach Südamerika — insbesondere n a ' ' Brasilien. Argentinien, Uruguay und Chile, wo sie
unauffällig aber beharrlich sich zu Kirchengemeinden zusammenschlössen. Bis
1900 mag die Zahl der „Evangelischen" 500.000 erreicht haben, aber bis 1960
sprang diese Zahl auf etwa 5.000.000.
Den grössten Anteil an diesem Wachstum und Wirken evangelischen Einflusjes schreibt man den sog. „nicht-historischen" Kirchen, also den Sekten, Glaubensmissionen und anderen Randgruppen zu. Denn die Einwanderung erfolgte von
Gliedern der alten historischen Kirchen wie auch von solchen, die diesen christlichen „Gesellschaften" oder Sekten angehörten. Bemerkenswert dabei ist, dass die
„Pfingstler" und andere schnell wachsende Gruppen meist viel mehr einheimische
Anhänger haben und viel weniger Zuschüsse aus ihren Mutterländern erhalten als
alle anderen. E s ist aber auch Tatsache, dass sich wohl die Zahl der Missionare aus
dem „Ausland" stark vermehrt hat, aber die Zahl „einheimischer" Seelsorger viel
mehr gewachsen ist und jetzt dreimal grösser ist als die der „ausländischen". In
vielen Städten sieht man jetzt kleine und grosse protestantische Kirchengebäude
und an nicht wenigen Orten „sollen" Sonntags ebensoviel Protestanten wie Katholiken ihre Gottesdienste besuchen.
Die Lutheraner bilden neben den Katholiken eine dertgrössten, wenn nicht die
grösste christliche Konfession in Lateinamerika (etwa 900.000 getaufte Glieder,
von denen die meisten in Brasilien leben). Diese lutherische Kirche ist aber in erster Linie das Ergebnis der europäischen Einwanderung, nicht so sehr das einer
Missionsarbeit. Allerdings gab es eine lutherische Missionsarbeit, die von nordamerikanischen Lutheranern unter europäischen Einwanderern besonders in Brasilien und Argentinien durchgeführt wurde, schon seit Beginn der ersten Besiedlung durch Europäer. Die lutherischen Gemeinden wachsen heute „natürlich"
durch die rasche Bevölkerungszunahme und fühlen sich immer weniger als Fremdkörper (auch sprachlich) in der nationalen S t r u k t u r ihrer neuen Heimat. Trotzalledem sind die lutherischen Gemeinden gegenüber allen anderen
„Evangelischen" stark in der Minorität und laufen Gefahr, es immer mehr zu werden. —
Eine stärkere Missionsarbeit von n o r d a m e r i k a n i s c h e n lutherischen
75
Kirchen begann erst nach dem 2. Weltkrieg. So gibt es Sendlinge der „Amerikanisch-lutherischen Kirche" in Mexico, Kolumbien und Brasilien, der „Vereinigten
lutherischen Kirche" und der „Augsburgischen Synode" in Argentinien und Uruguay, solche der „Lutherischen Missourisynode"
arbeiten in 10 verschiedenen
Staaten Lateinamerika's. Daneben können wir noch auf die Arbeit lutherischer
„Glaubensmissionen" in Mexico, Ecuador und Bolivien hinweisen.
Lateinameri'ka braucht das Evangelium mehr als je zuvor, aber es ist nach
den Erfahrungen nicht ratsam, dass ausländische Missionare die Verkündigung
übernehmen; das gilt übrigens ebenso f ü r die katholische Kirche. Das Selbstbewusstsein ist in allen Nationen ein charakteristischer Ausdruck, gerade bei denen, die eine „rasche soziale Umwälzüng" durchmachen. Es gibt keinen Ersatz
f ü r eine tatkräftige einheimische Führung. Wir können heute von der Tatsache
ausgehen, dass lutherische Kirchen sich in jeder der zentral- und südamerikanischen Republiken befinden, und vielversprechende leitende Mitglieder unter sich
zählen; so könnte man 3 Punkte als augenblicklich dringend und notwendig herausstellen: 1) Dass diese lutherischen Kirchen enger zusammenarbeiten, 2) dass
die übrige lutherische Welt ihnen in ihren Aufgaben hilft und 3) dass alle evangelische Arbeit sich in die grosse soziale Unruhe Lateinamerika's recht und billig
einfügt. Denn falls die Christen nicht die Führerschaft in dieser grossen Bewegung übernehmen, die auf einen berechtigten höheren Lebensstandard im allgemeinen zielt, so werden es die Nichtchristen oder die Antichristen tun. Dies ist
zwar ein negatives Argument, aber sicherlich sehr ausschlaggebend. Die Gesamtzahl der Kommunisten in Lateinamerika beträgt annähernd 210—230.000 Mitglieder, also 'viel weniger als die Zahl der Mitglieder in den lutherischen Kirchen.
Die Partei als solche ist nur in einem Drittel der Staaten anerkannt, aber sie
k ä m p f t überall um Legalität. Die USSR, Rotchina und ihre Satellitenstaaten halten sich bereit, Käufe zu tätigen, Handel zu treiben und Tausende und Abertausende von Touristen in die Länder zu schicken, vor allem aber Vorteile aus der
Revolution in Cuba zu ziehen.
Eine der grössten Schwierigkeiten aller südamerikanischen Staaten liegt in
ihren Exporterzeugnissen, von denen immer nur 1 oder 2 alle andern weit übertreffen und daher die Haupteinnahme bilden müssen. (Wolle oder Kaffee oder
Kupfer oder Zinn usw.). Gerade dadurch dass der eine oder andere Hauptartikel
nicht abgesetzt werden 'kann, bilden sich dann die ausserordentlichen Nöte in soziale: Hinsicht.
Um allen nationalen und internationalen politischen und wirtschaftlichen
Schwierigkeiten zu begegnen, ist 1948 die „Organisation der amerikanischen Staaten" ins Leben gerufen. Sie stellt eine erfreuliche Einheit in ihrer Zielsetzung dar
und geht zurück auf panamerikanische Zusammenkünfte, die es etwa seit 1889
gab. Die einseitige Monroe-Doktrin der U. S. A. wird nun allmählich durch gegenseitige Übereinkünfte ersetzt, wobei schon folgende gemeinsame Abkommen getroffen wurden: „Nicht-Einmischung" (1933), „Aufrechterhaltung des Friedens"
(1936), „gegenseitige Unterstützung" (1947), „Widerstand gegen kommunistische
Eingriffe" (1954). Am wichtigsten war wohl das Übereinkommen von Bogota
(1960), in dem ein gemeinsames Vorgehen auf wirtschaftlichem und sozialem
Gebiete getroffen wurde. Noch nicht zu überblicken sind die Verträge aller ame76
rikanischen Staaten in Punta de Este (1961), die besonders den freien Handel
und Zollfreiheiten untereinander betreffen.
Welche Stellung nimmt nun in all diesen politischen, kulturellen und speziell kirchlichen Entwicklungen das „Latein-Amerika-Komitee des Lutherischen
Weltbundes" ein? Auf alle Fälle ist dies Komitee keine Kirchenleitung und will es
auch nicht werden. Jedoch liegt diesem Latein-Amerika Komitee sehr viel daran,
dass seine Mitgliedkirchen die 3 Punkte beachten, die wir in diesem Aufsatz herausstellen, vor allen Dingen daran, dass die Verkündigung des Evangeliums sich in
den grossen Rahmen der sozialen revolutionären Aufgaben in Lateinamerika einfügt. Das Lateinamerika-Komiteb des LWB. wird dabei selbst folgende Richtlinien beachten:
1) Anregung zur Koordination auf nationaler Ebene:
Die Gemeinden verschiedener Sprachgruppen sollen sich zu einer Gemeinde
zusammenschliessen, ihr Seelsorger sollen oft zusammenkommen, damit so Synoden und Kirchen entstehen. Diesen Körperschaften soll durch Anleihegelder geholfen werden, notwendige Bauten auch bei herrschender Inflation schneller zu
erstellen. Diese Anleihen werden nach Rückzahlungen weiter vergeben usw.
2) Anregung zur Koordination auf internationaler Ebene:
Ausbildung auf theologischen Seminaren in Lateinamerika, um den .Nachwuchs aus den Ländern selbst heranzubilden, Kirchlicher Lesestoff und Gesangbuch in spanischer Sprache, Zusammenberufung von Kursen und Freizeiten an
verschiedenen Orten des Kontinents. Hilfe bei .Katastrophen oder Epidemien im
Sinne des „Weltdienstes des Luth. Weltbundes".
Es ist ersichtlich, dass diese Hilfen allein nicht genügen, wenn nicht die lutherischen Gemeinden sich dauernd um das Wohl der Volksgemeinschaft und der
nationalen Fürsorge in den einzelnen Ländern kümmern. Es muss u. a. dabei
versucht werden, neue Ländereien zur Besiedlung oder als Wohnstadt um ein Industriezentrum zu gewinnen. Ansätze dazu finden sich an verschiedenen Stellen.
Es wird dabei weiterzuarbeiten sein, nicht nur im Organisieren, sondern auch in
der richtigen christlichen Seelsorge.
77
D. RUDOLF OBERMÜLLEK — Buenos Aires
Vielerlei Kirchen — ein Herr
L
Die Einheit der Kirchen wird in Lateinamerika auf recht verschiedenen Wegen gesucht. Vorausgegeben ist die Lage: „in Lateinameriika leben die Kirchen
voneinander isoliert; das ist eine Situation der Schwäche, die durch miteinander
konkurrierende evangelistische Bemuehungen weiter erschwert wird" (Mitteilungen aus der Studienabteilung V, Nr. 1 u. 2, I E Abs. 11). Diese Isolierung ist geografisch, sprachlich, konfessions-traditionalistisch, soziologisch verursacht
und
wird im Rahmen dieser Ursachen weiterhin naiv oder 'bewusst festgehalten. Man
müsste also diesen Ursachen nachgehen, um ein greifbares Bild zeichnen zu können und daraus die verschiedenen Formen der Organisation und der Strategie in
der Evangelisation dort zu verstehen.
So gibt es Kirchen, deren Einheit in der Gemeinsamkeit übereinstimmender
theologischer Überzeugungen gesucht wird, wie z. B. in der römisch-katholischen
Kirche, in vielen Baptistengemeinden, bei den sogenannten Darbysten, in der lutherischen Kirche der Missourisynode und anderen. Sie tragen damit zur Isolier u n g bei.
So gibt es ferner Kirchen, deren Einheit in der Zusammenfassung gleichartiger Begabungen gesucht wird, z. B. in den Heilungsbewegungen oder in der Glos>solalie vieler pfingstlicher Gemeinden. Auch dies fördert die Isolierung.
E s gibt aber auch Kirchen in Lateinamerika, die in der Gemeinschaft verschiedenartiger theologischer Überzeugungen ihre Einheit suchen, und ihre Zahl ist
nicht gering. Anglikaner, Episkopale, Orthodoxe, Lutheraner des Lutherischen
Weltbundes darf m a n wohl so charakterisieren; auch die Methodisten, die Disciples oí Christ und manche brasilianischen Presbyterianer, denen die Disziplin mindestens ebenso wichtig ist wie Doktrin, denken so. Sie können wenigstens prinzipiell die Isolierung verringern.
Und es gibt auch Kirchen, die eine Gemeinschaft verschiedenartiger Begabungen sein wollen. Viele geben dem Laien seinen Platz neben dem Fachtheologen,
oder man fasst den Agronomen, den Mediziner, den Juristen, den Soziologen und
den Theologen zu einer Arbeitsgruppe zusammen. Auch so öffnet sich ein Weg
von der Isolierung zur Einheit des Handelns.
Damit entstehen die Organisationen der Kirchenbuende (Federaciones). Sie
können Allianzcharakter tragen; so ist es meistens in Lateinamerika. Sie können
78
auch ökumenisch sein; aber das ist noch nicht sehr verbreitet. Auch die wenigen
ökumenisch gesinnten Männer und Frauen leben noch in einer gewissen Isolierung
von den uebrigen Christen ihrer Umgebung.
II.
Aus den angefuehrten Ursachen ¡haben es diese Kirchen in Lateinamerika nicht
leicht, zur Gemeinschaft in der Evangelisation zu kommen.
Sie gehen gerne den bequemen Weg, eine Kirche ohne die andere neben einander das Wort auszurufen und Menschen im Volke Gottes zu sammeln, also „miteinander konkurrierende evangelistische Bemuehungen" zu unternehmen, als ob
jeder der 12 Stämme Israels f u e r sich allein das ganze Volk darstellen könnte.
Die erste Gruppe, welche die Einheit von der theologischen oder charismatischen Übereinstimmung abhängig macht, tut sehr schwer, wenn sie einer Einladung folgen soll, in Gemeinschaft mit andersartigen Kirchen das Wort an die Welt
zu richten. Zwar geschieht es ab und zu, dass einige von ihnen einmal an einer g e meinsamen Evangelisation teilnehmen; aber nachher geschieht es dann häufig,
dass sie sich wieder distanzieren. Deshalb wäre es eine besondere theologische Bemuehung wert, einen Weg zu suchen, wie man sie zur Gemeinschaft heranfuehren
könnte, ohne dass dabei ihre Sonderueberzeugungen verletzt wuerden.
Die zweite Gruppe, welche die Kirche als eine Gemeinschaft verschiedenartiger Überzeugungen und Begabungen anerkennt, hat es selbstverständlich etwas
leichter, sich f u e r gemeinsame Evangelisation, f u e r „Einheit der Kirchen in der
Evangelisation" gewinnen zu lassen.
Argentinien — um nur 1 Beispiel f u e r viele zu nennen — hat jedes J a h r eine
evangelistische Woche im Boxerpalast Luna Park in Buenos Aires, die von einem
Ausschuss geleitet wird, an dem viele Kirchen teilnehmen; ihr von uns allen geliebter Vorsitzender ist ein Mennonit. Hier evangelisiert man MIT-einander. Oder
in einer anderen Woche vereinigen sich dort die deutsch sprechenden Gemeinden,
Baptisten, Lutheraner, Mennoniten, Reformierte, Kongregationale zu einer Bibelwoche auf der kleinsten Ebene der lokalen Kirchengemeinden. Hier evangelisiert
man FÜR-einander. In der Vorbereitung und D u r c h f ü h r u n g dieser Wochen e n t decken sich die Kirchen erst recht gegenseitig. Die Evangelisation bringt sie funktional zusammen. Die seelsorgerlichen Helfer lernen einander kennen und schätzen; ja, selbst so schwerfällig ethnische Inselgruppen wie die deutschen und die
schweizer Kirchen werden erfasst. Und wenn auch nachher bei der Zuteilung der
Neugewonnenen a n einzelne Gemeinden manche Eifersuechteleien und neue Isolierungsneigungen auftreten, so bleibt doch ein Segen davon dass man MIT und
FÜR einander gebetet hat, gepredigt hat, sich um Seelen gesorgt hat.
Nun war aber der Anlass zu dieser gemeinsamen Evangelisation ein anderer
als die Beschäftigung mit der ökumenischen Bewegung. Der Anlass kam aus Allianzkreisen. Somit bleibt Raum f u e r eine weitere vertiefende Besinnung aufgrund
dieser Erfahrungen mit der Evangelisation als Einheitsband der Kirchen.
E s wäre also auch f u e r Lateinamerika jedenfalls immer wieder zu betonen,
dass
79
III — die Einheit der Kirchen ein evangelistisches Zeugnis an und in sich
selbst ist, und dass
IV — die Einheit im evangelistischen Zeugnis von grösster kirchlicher und
theologischer Bedeutung ist.
III.
Es sei wiederholt: die Einheit der Kirchen sollte an und in sich selbst als
evangelistisches Zeugnis von der Fuelle des Heils Gottes in Christus eine P e r spektive der Kirchen und Gemeinden sein.
Dieser Satz ist freilich eine biblische Binsenwahrheit. Wir kennen alle, was
der Herr in Johannes 17:21 sagt. Aber es kann nicht oft genug wiederholt und
eingeprägt werden.
Es ist die Koinonia als Dimension der Evangelisation, Koinonia als Quelle der
Evangelisation, als Weg und Mittel, als Folge und Ziel der Evangelisation. In der
"Theologischen Besinnung ueber die Evangelisation" (Mitteilungen V, N r . 1 u. 2,
III, C S . 25 — IV F2 S . 33 — V D 1 u . 2 S. 38/39) islt zu dieser Sache genuegend
zu lesen. Diese Koinonia ist das MIT und FÜR einander, demgegenueber sich das
OHNE und GEGEN einander als etwas Enges und Kuemmerliches enthuellt.
Aber nun ist es eben die grosse Frage, welches der Weg sei, um die Einheit
der Kirche als ihr evangelistisches Zeugnis zu manifestieren. In Lateinamerika ist
die ueberwiegende Mehrheit der Christen, wie man das so nennt, „fundamentalistisch'- gesinnt; und das isoliert sie, denn es erlaubt allenfalls nur eine allianzartige Zusammenarbeit in den Kirchenbuenden. Soweit es aber Leute gibt, die ein
ökumenisches Verständnis der Kircheneinheit anstreben, gelten sie den andern
als „Modernisten" oder „Unionisten". Dieses Misstrauen ist kaum zu ueberwinden, und so lange als es besteht, wird es schwierig sein, die Einheit der Kirchen
als evangelistisches Zeugnis zu gewinnen.
IV.
Einstweilen haben wir aber doch jetzt schon eine Einheit der Kirchen i n ihrem
evangelistischen Zeugnis.
Es wird in. Lateinamerika kaum eine Gemeinde geben, welche auf die Dauer
ausschliesslich f u e r sich selbst leben will und ihre Diaspora-Situation als eine
Ghetto-Situation ansehen, ja sogar sich damit zufriedengeben wuerde. Selbst die
ethnisch geschlossenen Gruppen in Brasilien, Chile, Argentinien, Paraguay, U r u guay öffnen sich mehr und mehr; Ungarn, Letten, Buren, Deutsche, Schweizer
usw. nehmen mehr und mehr ihre Verantwortung f ü r ihre Umwelt wahr, um
ihr das Evangelium mitzuteilen, da sie ja in dieser Umwelt leben und arbeiten.
Theologisch verwandte Überzeugungen streben nach Unitas, ohne an Union
zu denken (Einheit, ohne Vereinigung). So ruecken am La Plata die Methodisten,
Waldenser und Disciples of Christ immer enger zusammen. Auch theologisch widerstreitende Überzeugungen kommen ins Gespräch miteinander, angesichts der
grossen gemeinsamen Aufgabe suchen sie wenigstens einander, und so kuehn es
klingen mag, so wahr ist es dennoch, dass selbst zwischen der römisch-katholi80
sehen Kirche und den Protestanten an manchen Orten ein Wettbewerb an die
Stelle des Widerstreits getreten ist.
In diesem Raum der gemeinsamen Aufgabe der 'Evangelisation kann man die
Frage stellen: WAS ist es denn, das uns f u e r die Evangelisation zusammenhält?
Bei der Antwort verändert sich die Fragestellung. Die neue Frage heisst dann:
WER f u e h r t uns zur Evangelisation zusammen? Vom WAS zum WER f ü h r t
derselbe Weg wie von der Ekklesiologie zur Christologie. Und dann ist es der
H E R R selber, der kommende Herr, und sein Wort in der Bibel selber, in der Bibel, die uns ja allen gemeinsam ist, den Isolierten ebensogut wie den Verbundenen.
ER stiftet die Einheit der Kirchen, die wir suchen. Diese Einheit i m evangelistischen Zeugnis weist hin auf die Einheit a 1 s evangelistisches Zeugnis, also auf
IHN selber, „auf dass sie alle eines seien
auf dass die Welt glaube, du habest
mich gesandt" (Johannes 17:21). Dabei sind die „alle" erst in zweiter Linie wichtig; wichtig in erster Linie ist, dass derjenige offenbart wird, von dem die Sendung
ausgeht, und derjenige, in dem. sie alle gesammelt werden.
V.
Abschliessend sei nochmals ein Wort zur Lage in Lateinamerika im besonderen gewagt.
Lateinameri'ka hat es ganz besonders nötig, dass in der Evangelisation Einheit
der Kirchen da ist. Ausser dem biblischen Grunde zeichnen sich auch einige lokale Gruende ab.
Da ist die römisch-katholische Kirche mit ihrer Einheitlichkeit. Wenn ihr
gegenueber die Protestanten ein gutes Zeugnis ablegen wollen, dann muss es eine
Hilfe f u e r die römisch-katholischen Christen sein, nicht nur in den Nöten und Anfechtungen um die Rechtfertigung des Suenders allein aus Glaubein, sondern ausserdem auch f u e r den Weg, auf dem sie zur wahren vollen Einheit der Kirchen
in Christus kommen können. Wie aber könnte ihnen eine Evangelisation der Kirchen gegen, ohne oder neben einander helfen? Wir sind ihnen eine Evangelisation
schuldig, die beispielhaft zeigt, was es heisst, mit und f u e r einander das Evangelium zu verkuendigen.
Da sind die grossen Massen, die der Religion gleichgueltig oder ablehnend geg e n ü b e r s t e h e n , und da sind die kleinen Kreise, in denen noch etwas von der präkolumbianischen Religion der Indios armselig weiterlebt. Ihnen schulden wir ein
Zeugnis von der ganzen Fuelle des Heils, und das ist mehr als nur die Einladung,
man möge sich an eine der hunderte von evangelischen Kirchen anschliessen.
Hierin mag das Besondere, das Eigene der Lage in Lateinamerika gegeben
sein. In Afrika geht es um den Islam und das christlich gefärbte messianische
Sektentum (wenn ich recht sehe). In Asien haben wir das Gegenueber der grossen Religionen. In Nordamerika ist ja wohl die römisch-katholische Kirche kein
so ueberragendes Gegenueber. So mag es berechtigt sein, Lateinamerika als ein
Feld mit -besonderen Nöten und besonderen Verheissungen angesichts der Frage
nach der Einheit der Kirchen zu sehen.
81
Dr. FRIEDRICH HÜBNER — Hannover
„Von Schicksal und Sendung des Auswanderers"
Dass der Vorgang der Auswanderung und der Wiederansiedlung in einem anderen Kontinent eine tiefgreifende Existenzkrise darstellt, bedarf f ü r den, der selber ausgewandert ist, keines Wortes. Der Auswanderer bringt ein zusätzliches
Mass an Entschlusskraft und Unternehmungsgeist mit, das vielfach durch verzweifelte Lebensumstände herausgefordert wird, ihn aber auf jeden Fall aus der
ihm bisher bergenden Umwelt heraushebt und absondert. Und er wird sich immer
auf ein zusätzliches Mass an Schicksalsschlägen, Entbehrungen und Kraftproben
gefasst machen müssen, die ihm das Äusserste abfordern.
Es ist nicht verwunderlich, dass viele diese Krise nicht positiv bestehen. E s
wird viel beklagt, dass deutsche Auswanderer nach 1945 ganz besonders stark jener „Flucht nach vorne" verfallen, die gar nicht schnell genug alle Brücken zur
Vergangenheit abreissen und sich in den Strom des Neuen hineinstürzen kann. Sie
sind in der grössten Gefahr, aus diesem abrupten Bruch mit ihrer eigenen Vergangenheit und aus dieser verkrampften und oft charakterlosen Anpassungssucht
heraus zur Spreu zu werden, die der Wind zerstreut.
So wie das Fieber in einem kranken Körper im Grunde genommen ein Läuterungs- und Genesungsprozess ist, in dem kranke Stoffe ausgeschieden und die
ureigentlichen Lebenskräfte mobilisiert werden, so wird auch die Neuansiedlung
nur gelingen, wenn die innersten Kräfte der bisherigen Welt mithimülbergerettet
werden in die neue Umwelt und in einem organischen Prozess so transformiert, so
umgesetzt werden, dass sie neue Kräfte und Impulse entbinden. Hier liegt der
Schlüssel f ü r die Bedeutung und die Tragweite des „Vätererbes", der Heimattreue
und der Sprachkultur. Je härter das Schicksal den Auswanderer betroffen hat,
desto inniger und treuer hat er die Kräfte der Vergangenheit beschworen, um die
neuen Lebensumstände zu meistern. Gerade aus dem Auswandererschicksal sind
dem deutschen Heimat- und Kulturbewusstsein wichtige und unaufgebbare Erkenntnisse zugeflossen.
Allerdings hat sich auch gezeigt, dass es gewisse Formen des Festhaltens am
Erbe der Väter gibt, die über das Ziel hinausschiessen, und zur Stagnation und Erstarrung führen. Wenn der Blick ausschliesslich rückwärts gewandt ist, wenn man
nur aus dem Erbe zehren möchte und sich ängstlich vor jeder existentiellen Auseinandersetzung mit dem Neuen hütet, wird das Erbe steril und die Treue zum
Verrat. Und eines Tages bricht dann doch die hohl und heuchlerisch gewordene
82
Tradition des Vätererbes so plötzlich und erschreckend zusammen,dass ein echter
Kulturbeitrag in der neuen Umwelt illusorisch wird..
In. diesen weitgreifenden Zusammenhängen muss die Frage der kirchlichen
Verantwortung lutherischer Einwanderer in Latein-Amerika gesehen und beJacht werden.
Es ist keine Frage, dass die Staaten Lateinamerikas ¡gut beraten waren, als sie
sich bei der Suche nach zuverlässigen Kolonisten auch nach Deutschland wandten
und evangelischen Einwanderern freie Ausübung ihres Glaubens
zusicherten.
Wenn es mit der Erfuellung dieser Zusagen nicht immer so ¡ganz stimmte, war das
nicht alleine Schuld der Regierungen. Wenn es das Bestreben der Staaten war,
einen bäuerlichen und handwerklichen Mittelstand zu schaffen und Bürger zu gewinnen, auf die sich das Staatswesen aufbauen konnte, dann konnte ihr nicht mit
charakterlosen Konformisten in religiöser Beziehung gedient sein, ganz abgesehen
davon, dass auch die römisch-katholische Kirche keinen Wert auf Zwangskonvertiten legen konnte.
Die Kirche ist nun zweifellos ein Teil des „Vätererbes", das ein Auswanderer
mitbringt. Sie ist lebenswichtig f ü r den Prozess der neuen Einwurzelung. Es lässt
sich mannigfach belegen, dass auch solche Auswanderer, die in der alten Heimat
ihre Kirchenzugehörigkeit gar nicht besonders wichtig nahmeri,, in der neuen fremden Welt sich auf ihr kirchliches Erbe besannen oder zum mindesten empfanden,
dass ihnen ohne die Kirche etwas fehlt, was sie gerade jetzt besonders nötig gehäbt hätten. Leider haben die evangelischen Kirchen in Europa erst sehr spät ihre
Verantwortung f ü r die Auswanderer erkannt. Aber das Fragen nach der Kirche
seitens der Auswanderer hat vielfach zur Selbsthilfe geführt und hat so nach
Jahrhunderten volkskirchlicher Tradition in Europa zur Entwicklung des Freiwilligkeitstyps der Kirche in der Neuen Welt geholfen. Denn nur aus freiwilligem
Entschluss und dem bewussten Opfer der einzelnen Mitglieder konnten neue Gemeinden, Synoden und Kirchen aufgebaut werden.
Noch wichtiger fast wurde eine zweite E r f a h r u n g : Die Kirche ist nicht nur
ein Teil des Vätererbes unter anderen, sondern sie ist der wichtigste, am längsten
wirksame, letztgültige Teil. Alle anderen Lebensformen und Traditionen der Heimat schleifen sich notgedrungen, selbst bei grösster Treue von Generation zu Generation, mehr ab. Die Arbeitsmethoden der Landwirtschaft wandeln sich, die
Sitten und Gebräuche der täglichen Lebensfuehrung in Haus und Familien geraten in Vergessenheit, die Eigentümlichkeiten der Urteilsbildung und des sprachlichen Ausdrucks verschwimmen, auch die Beherrschung der Heimatsprache
wird, wenn nicht aussergewöhnlich glückliche Umstände obwalten, geringer und
geringer — das alles erscheint als ein beklagenswerter, aber auf lange Sicht doch
unaufhaltsamer Prozess. Natürlich gilt es, mit allen Mitteln die Widerstandskraft
zu wecken. Besonders wichtig wird es sein, zum mindesten die Zweisprachigkeit
so lange wie irgend möglich zu erhalten. Kein Opfer wird dafür zu hoch sein, denn
gerade durch diese zusätzliche kulturelle Leistung wird der Horizont dieser Staatsbürger der neuen Welt erweitert und ihr Beitrag zur Entwicklung dieser neuen
Heimatländer intensiviert.
Es ist selbstverständlich, dass die Kirche in diesem. Kampf um die Bewährung
des Vätererbes eine wichtige Funktion ausübt — das wissen auch kirchlich Unin83
teressierte und sind darum bereit, kirchliche Aktivität zu unterstützen. Aber es
gehört zur Eigenart echten kirchlichen Lebens, dass man es nicht zum Kulturträger
schlechthin degradieren kann, ohne es in seinem Wesen zu zerstören. Die Kirche
wird immer Kulturträger im Nebeneffekt sein und zwar um so stärker, je mehr
sie echte Kirche ist, aber sie wird immer alle Kultur transzendieren, weil sie aus
der ewigen Anrede Gottes an den Menschen lebt und am ersten nach dem Reich
Gottes zu trachten hat, das nicht von dieser Welt ist. Darum wird im letzten Grunde erst jener Mensch wurzellos, der die Bindung an die Kirche, in der er getauft
und konfirmiert ist, verliert. Die Kirche allein ist darum in der Lage, dem Auswanderer im besonderen in der unausweichlichen Existenzkrise jenes letzte F u n dament zu gewähren, das auch noch unerschüttert bleibt, selbst wenn alle anderen hohen Güter der Vergangenheit mehr und mehr dahinschwinden. Die Kirche
wird darum sich immer wieder die Freiheit schenken lassen müssen, dem Auswanderer so zu dienen, wie er es benötigt, in der Muttersprache der alten Heimat, in
der Zweisprachigkeit, die in der neuen Heimat sich ergibt und schliesslich auch,
wenn es nicht anders mehr sinnvoll ist, in der Einsprachigkeit der neuen Welt, in
der der Auswanderer sich nunmehr zu Hause und geborgen fühlt.
Eine besondere Zuspitzung erhält diese Verantwortung lutherischer Einwanderer in der latein-amerikanischen Welt. Hier handelt es sich um Länder, die seit
400 Jahren von Portugal und Spanien her erobert und christianisiert worden sind
— in jener Geschlossenheit von Kirche und Staat des Mittelalters, f ü r die es kein
Widerspruch war, beutegierige Eroberungen mit dem missionarischen Auftrag
der Kirche zu motivieren. 350 J a h r e lang hat die römische Kirche das Gesicht dieser Länder geprägt. Dabei haben die römischen Missions-Gesellschaften sich heiss
bemüht, den alteingesessenen Bewohnern dieser Länder beizustehen und sie innerlich f ü r die Kirche zu gewinnen. Aber es ist auch kein Geheimnis, dass ihre
K r ä f t e nie ausgereicht haben, mit der raschen Entwicklung Schritt zu halten. Darum bietet die römische Kirche hier ein zwiespältiges Bild: auf der einen Seite
grosse Macht- und Prunkentfaltung in den Städten und Verkehrszentren, aber
auf der anderen Seite viel zu wenig und gering ausgerüstete Priester und oberflächliche oder fast gänzlich mangelnde Unterweisung des Volkes in den unendlich weiten Landgebieten. In Latein-Amerika hat die römisch-katholische Kirche
nie die innere Neugeburt erfahren, die in Europa auch f ü r sie die Folge der Reformation gewesen ist.
Da die Bevölkerung Latein-Amerikas in ihrer einzigartigen Blutmischung von
Indianern, Europäern und Negern, aber religiös durchaus aufgeschlossen und empfänglich ist, ist ein religiöses Vakuum entstanden, das sich in den letzten J a h r zehnten, etwa seit der Jahrhundertwende, ungeheuer rasch auffüllt mit den disparatesten Religionsformen von den ernstzunehmenden protestantischen Missionen bis hin zu den unheimlichsten Mischformen von afrikanischer Magie, Spiritismus und ekstatischen Sekten.
In dieser Lage wird die besondere Verantwortung lutherischer Einwanderer
deutlich. Sie waren in der neueren Geschichte die ersten Protestanten, die in diese
Länder gekommen sind. Es mag füglich bezweifelt werden, ob Kaiser Don Pedro,
der die ersten lutherischen Einwanderer in sein Land, Brasilien rief, wirklich hat
ahnen können, was f ü r Folgen sein Erlass haben musste. Tatsache ist, dass die
84
lutherischen Einwanderer aus dem Mutterlande der Reformation und aus den
übrigen europäischen Ländern hier in dem neuen Kontinent sich in ähnlicher Doppelfrontstellung vorfanden wie in Europa: Der römisch-katholischen Kirche gegenüber müssen sie sich auf den Wesensgehalt reformatorischer Verkündigung
besinnen und so zum ersten Mal die römische Kirche zur echten geistlichen Auseinandersetzung zwingen. Auf der anderen Seite müssen sie den unendlich vielen
Splittersekten und Gruppen extrem protestantischer Prägung, also der schwärmerischen Entsteilung der biblischen Botschaft gegenüber unter Beweis stellen, dass
sie die eine heilige apostolische Kirche repräsentieren. Es ist also eine wahrhaft
ökumenische Verantwortung, die sich auf die Schultern lutherischer Einwanderer legt. Es ist kein Zweifel, dass das Schicksal und die Entwicklung dieser so
rasch aufblühenden Völker in Latein-Amerika entscheidend mitbestimmt werden
von der Frage, ob die reformatorische Verkündigung von der Rechtfertigung des
Sünders aus Gnaden und aus Glauben allein hier verkündigt und geglaubt wird
oder nicht. Noch stellen die lutherischen Christen und Gemeinden die bei weitem
grösste Zahl der Protestanten in Latein-Amerika dar. Es ist das Bemühen des Lutherischen Weltbundes, die so weit zersprengten Gruppen in engere Fühlung miteinander zu bringen und ihnen zu helfen, das Zeugnis ihres Glaubens ihren Mitmenschen nicht schuldig zu bleiben. Dazu dienen die latein-amerikanischen Konferenzen, von denen die erste 1951 in Curitiba und die zweite 1954 in Petropolis,
also beide in Brasilien, stattfanden, weil die „Evangelische Kirche lutherischen
Bekenntnisses in Brasilien" mit ihren 600.000 Gliedern und 200 P f a r r e r n als Mitgliedskirche des Lutherischen Weltbundes eingeladen hatte. Die dritte Konferenz
dieser Art hat im April 1959 in Buenos Aires stattgefunden. Auf allen diesen Konferenzen hat Propst Karle f ü r die Evangelisch-Lutherische Kirche in Chile
bahnbrechend und wegweisend mitgewirkt. Darum sei ihm dafür auch an dieser
Stelle gedankt.
85
EMIL BÖNING, früher Santiago (Geistlicher der deutschsprechenden Katholiken)
Die Flüchtlinge aus der Zeit nach dem zweiten
Weltkriege als Seelsorgsproblem
Die Entwicklung der Weltpolitik nach dem zweiten Weltkriege, vor allem
die Zerreissung der Völkergemeinschaft in zwei sich bekämpfende
politische,
wirtschaftliche und soziale Systeme, stürzte Millionen von Menschen in das
grosse Elend der Heimatlosigkeit. Von 1945 bis 1958 wurden über dreissig Millionen Menschen wegen ihrer Nationalität, Rasse, Religion oder politischen Überzeugung verfolgt, beraubt und aus ihrem Vaterlande verjagt. Der grösste Teil
dieser Millionen waren (Deutsche oder sogenannte Volksdeutsche; aber das gleiche grausame Schicksal traf auch Hunderttausende von Weissrussen, Ungarn,
Poien, Juden, Armenier, Griechen, Inder, Algerier und Araber.
Nur ein verhältnismässig geringer Teil dieses Menschenstromes erreichte
Chile und fand hier eine neue Heimat, im ganzen rund 7.500. Diese Zahl ist, gemessen an dem Riesenausmass des 'Flüchtlingselends, gewiss klein; sie bedeutete
trotzdem f ü r Chile in vieler Hinsicht ein grosses Problem.
Wie in Europa waren auch in Chile, vor allem in den ersten Monaten nach
dem Waffenstillstände, die Flüchtlinge fast ausschliesslich auf private Hilfe angewiesen, weil, die diplomatischen Beziehungen zwischen Chile und den Herkunftsländern der Flüchtlinge meist unterbrochen und die grossen internationalen Hilfsorganisationen noch nicht gebildet waren.
» An erster Stelle — wegen ihres Berufes und ihrer Nationalität — trat die
Aufgabe, den Unglücklichen zu helfen, an die deutschen Seelsorger heran. Die
Mehrzahl der Flüchtlinge kam aus deutschen Sprachgebieten. Und von der Kanzel herunter hatten die Seelsorger ihren Gemeinden J a h r f ü r Jahr die Christusworte vorgelesen und erklärt: „Ich war fremd, und ihr habt mich aufgenommen;
ich war nackt, und ihr habt mich bekleidet... Wahrlich ich sage euch, was ihr
einem von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan!" Nun galt es, dieses Herrenwort nicht nur zu predigen und anzuhören, sondern in die Tat umzusetzen.
Zunächst musste der nackten Armut geholfen werden durch eine menschenwürdige Wohnung, durch Geld, Brot und Kleidung. Über die kurzfristige materielle Hilfe hinaus musste man für Verdienstmöglichkeiten sorgen. Handwerker
mussten ihre Werkzeuge und, wenn eben möglich, ihre eigene Werkstatt erha]86
ten. gelernte und ungelernte Arbeiter mussten in Betrieben angestellt, Kinder in
Horten und Schulen untergebracht werden.
Ungezählte Probleme dieser Art lösten die Seelsorger mit Hille hochherziger
Gemeindemitglieder der „Acción Católica" und des „Deutschen Hilfsvereins", des
„Evangelischen Hilfswerks" und der „Caritas". Der Seelsorger der Gemeinde
deutschsprechender Katholiken in Santiago gründete ausserdem unter Chilenen
Spaniern und Deutschchilenen den Verein „Amigos de los Pobres", der jahrelang arme Flüchtlinge ohne Rücksicht auf Herkunft und Bekenntnis mit bedeutenden Geldmitteln unterstützte, vor allem Handwerkzeug und Werkstätten e r warb und Schulgelder und Pensionen f ü r Lehranstalten und Internate zahlte.
Ausserdem rief er unter Nichtohristen den Hilfsverein „Amigos de los Niños" ins
Leben, der sich der nichtchristlichen Flüchtlingskinder annahm, aber auch grosse
Summen f ü r die armen Kinder Deutschlands und Österreichs überwies.
Die zweite, weitaus wichtigere und schwierigere Aufgabe war f ü r die Seelsorger die Linderung der seelischen Not der Flüchtlinge. Meist ohne eigenes Verschulden in ihrer menschlichen Würde verletzt und erniedrigt, der wesentlichen
Grundrechte der menschlichen Persönlichkeit beraubt, nicht nur von der Heimat,
sondern auch von ihren eigenen Angehörigen gewaltsam getrennt, kam die grosse
Mehrheit der Flüchtlinge mut- und hoffnungslos, misstrauisch, verbittert und
verzweifelt in das Land, das ihnen zur neuen Heimat werden sollte. Sie brauchten deshalb nicht nur Wohnung, Brot und Arbeit, sie bedurften mehr noch des
guten Rates, des gütigen Verstehens, des freundlichen Vertrauens. Deshalb suchten die Seelsorger durch Besuche und im persönlichen Gespräche das Vertrauen
der Flüchtlinge zu gewinnen und das Selbstvertrauen wieder zu erwecken, aber
auch in ihren Gemeinden das Bekannt- und Freundwerden zwischen Altmitgliedern und Neugekommenen zu fördern. So wurden die Flüchtlinge immer wieder
und herzlich zum Gottesdienste und den Festen der Gemeinde eingeladen, nicht
als Fremdlinge und zufällige Gäste, sondern als willkommene Brüder und Schwestern. Auf diese Weise ist dann auch im Laufe der J a h r e eine grosse Zahl ehemaliger Flüchtlinge in das Gemeindeleben hineingewachsen, und durch die Mithilfe von Seelsorgern und Gemeinden auch wirtschaftlich und gesellschaftlich im
Boden der neuen Heimat verwurzelt.
Noch ist der Flüchtlingsstrom nicht versiegt, und die Flüchtlingsprobleme
sind längst nicht alle gelöst. Mögen die Seelsorger f ü r die Lösung dieser Probleme in ihren Gemeinden wie bisher — und noch mehr — Verständnis und Hilfe
finden! Und möge das gemeinsame Arbeiten im Dienste der Liebe Christi zur
inneren Gemeinschaft aller beitragen!
87
ROLAND HENKE — Temuco
Begegnung mit der Mutterkirche
Junge Chilenen besuchen Gemeinden der Evangelischen Kirche in Deutschland
E s erweckt in Chile immer wieder besonderes Interesse, wenn Gruppen- oder
Einzelreisen nach Deutschland unternommen werden, da die Verbindungen von
Chile nach Deutschland sehr vielfältig, aufrichtig und herzlich sind. Jeder Besucher aus Deutschland wird darum auch hier ueberaus gastlich aufgenommen und
hoch geehrt, und ebenso will nicht nur der Chilene, dessen Vorfahren einst aus
Deutschland kamen, sondern ein grosser Teil der aufgeschlossenen Ibero-Chilenen
Deutschland kennenlernen. So ist f u e r den Menschen hier in Chile das Erlebnis
einer Besuchs- und Studienreise nach Deutschland derartig tiefgreifend, dass davon meist seine Lebensform und seine geistige Einstellung f u e r die Zukunft geprägt bleibt, zumal viele Verbindungen hinueber und herueber das erwachte Interesse und die gewonnenen Erkenntnisse lebendig zu erhalten suchen. Man kann
deshalb den Chilenen nicht mit Klischees abspeisen, da er sich selbst ein wirkliches, persönliches Urteil zu verschaffen sucht. Bisher war es nun so, dass Reisebueros und Volkstumsgruppen sehr feine und beachtenswerte Reisen mit den
verschiedensten Absichten unternommen haben, wobei die vielfältigsten Eindruekke aus einer Fuelle von Besuchen, Begegnungen und Besichtigungen nach hier
fliessen.
So erwachte auch in der Gemeindejugend der deutschen Evangelischen Gemeinde in Temuco der Wunsch, einmal unter der Leitung ihres P f a r r e r s eine grössere Studien- und Besuchsreise nach Deutschland zu unternehmen, um das kirchliche Leben der Mutterkirche und darüber hinaus die sozialen, wirtschaftlichen,
kulturellen und sonstigen Verhältnisse kennenzulernen, von denen hier so viel
Wunderbares berichtet wird. Aber vor allem bestand das Verlangen, durch die
Möglichkeiten der Gemeindebesuche vor allem dem deutschen Menschen dort zu
begegnen, wo er lebt, wohnt, arbeitet, feiert und betet.
Diese Gruppe in Temuco von berufstätigen männlichen und weiblichen jungen
Menschen im Alter von etwa 20 bis 30 Jahren, an die sich noch einige Teilnehmer
aus verschiedenen anderen Gemeinden unserer Evangelisch-lutherischen Synode
in Chile angeschlossen hatten, unternahm nun in der Zeit von August 1960 bis
März 1961 eine umfassende Rundreise durch Gemeinden der Evangelischen Kirche
in Deutschland, wobei auf der Durchreise auch verschiedene Gemeinden in Buenos
Aires und die Evangelisch-Lutherische Gemeinde in Genf besucht werden konnten.
SS
Diese Reise war durch jahrelange, intensive und mühevolle Kleinarbeit vorbereitet worden und stand in ernsthafter Gefahr, durch die Folgen der schweren Erdbebenkatastrophe in Chile aufgegeben zu werden. Doch die Teilnahme der Gruppe, die samt und sonders aus dem Erdbebengebiet kamen, sahen sich gerade jetzt
durch die schweren Ereignisse gedrungen, nun erst recht die lang vorbereitete
Reise, die infolge der festen Abschluesse garnicht mehr rueckgängig gemacht
werden konnte, ganz gewissenhaft durchzuführen. Auf diese Weise glaubten sie,
über die ursprüngliche Absicht und vorgesehenen Zweck der Reise hinaus, den
Dank f ü r alle Hilfe, die so viele Institutionen und vor allem die evangelischen
Gemeinden durch die grosszügigen Hilfswerkssendungen ihrem Heimatland gebracht hatten, abzustatten; denn das war von nun an klar, dass solch eine Reise
f ü r so lange Zeit, wie sie festgelegt war, höchst persönliche Anstrengungen und
Hingabebereitschaft verlangen würde.
Aus den bereits vor dem Erdbeben eingetroffenen 150 Einladungen wurden
nach sorgfältiger P r u e f u n g zirka 50 Gemeinden ausgewählt, und der Zeitraum
des jeweils erbetenen Besuches stark verkuerzt, um eine möglichst grosse Streuung durch alle Landeskirchen ueber die gesamte Bundesrepublik und Westberlin
während des vorgesehenen Zeitraumes zu erzielen. Diese Auswahlaktion war oft
f u e r beide Teile schmerzlich, weil dadurch sehr herzlich und vielseitig gehaltene
Einladungen ausgeschieden werden mussten.
Von Genua kommend, wohin wir mit einem sehr einfachen und zugleich
ueberfuellten Dampfer gereist waren, wurde zunächst nach dem Besuch von Genf
der suedwestdeutsche Raum mit Gemeinden in Alpirsbach, Schramberg, Tuebingen, Stuttgart, Karlsruhe, Bretten, Hockenheim und Heidelberg besucht. Einer
Einladung des Gustav Adolf-Werkes zu seiner Haupttagung folgend, ging es dann
nach Berlin, wo wir uns wegen der Wichtigkeit dieses Platzes ausnahmsweise 10
Tage aufhielten, um dann ueber Ahrensburg, Hamburg, Kiel und Hagen bei Bremen in den Raum der braunschweigischen Landeskirche zu gehen. Es wurden
Wolfenbuettel und Salzgitter besucht, woran sich auf Einladung der braunschweigischen Kirche und des Landesjugendpfarramtes ein kurzer Freizeitaufenthalt im
Harz anschloss. Von Bethel, das alle Teilnehmer tief erschuetterte, f u h r e n wir
ins Ruhrgebiet mit vielen sehr gastlichen Aufenthalten in den Gemeinden in Remscheid, Castrop-Rauxel, Essen, Elberfeld-Obenbarmen und Duisburg, um dann über
das Evangelische Aufbaugymnasium in Herchen an der Sieg, Linz am Rhein und
Worms noch einmal in der Adventszeit in Hockenheim einzukehren. Die Gruppe
war dann Gast bei Gustav Adolf Gedat auf dem Internationalen Forum auf der
Burg Liebenzell. Dort verbrachte auch ein grosser Teil der Teilnehmer die Weihnachts- und Neujahrstage mit einer sehr bunt zusammengewuerfelten Jugend aus
der ganzen Welt, wodurch viele weltweite Venbindungen angeknüpft werden
konnten. Der letzte Abschnitt der Reise begann in Königstein-Taunus mit Falkenstein und ging ueber Wiesbaden, F r a n k f u r t , Schlitz, Forchheim in Oberfranken.
Nuernberg, Amberg in der Oberpfalz und Muenchen nach Übersee am Chiemsee.
Von allen diesen Besuchszentren wurden dann durch die offenherzige Gastfreundschaft der Gemeinden und der Gastgeber herrliche Rundfahrten in die nähere und
weitere Umgebung durchgefuehrt.
Auf dieser Reise wurde einmal von den Besuchern ein recht ansprechendes
89
und besinnliches Spiel aus dem Leben der Araukaner, deren Reste noch im Reservat um Temuco leben, mit dem Titel „Guacolda spricht" von Wenzel v. Reisswitz,
den gastgebenden Gemeinden geboten und zum anderen wurden Buntdias aus dem
Leben der Gemeinde im Bezirk Temuco, von Land und Leuten der Frontera und
erschuetternde Bilder von der Erdbebenkatastrophe vorgefuehrt. Umrahmt wurde
dieser Lichtbildervortrag durch chilenische Volkslieder und Tänze in der Tracht
der huasos, der chilenischen Landbevölkerung. Mehrmals kam es dabei auch zu
einer recht interessanten Begegnung mit Trachtengruppen und Volkstanzgruppen
wie z. B. in Schlitz, Übersee und auf Burg Liebenzell. Dass nun diese Darbietungen
unserer Gruppe bei der Vielschichtigkeit der Gemeinden, die wir besuchen konnten, auch sehr verschieden temperierte Aufnahme fanden, war durchaus zu erwarten und jedem Teilnehmer von vornherein k l a r . Von den meist uneingeschränkt lobenden Urteilen in der Tagespresse und in den kirchlichen Blättern
mit oftmals reichlichem Bildmaterial, wie u. a. in dem Evangelischen Gemeindeblatt f u e r Muenchen: „Reicher Beifall belohnte die 25 jungen Chilenen... fuer ihre
exakt einstudierten Einzel- und Ensembledarbietungen" ging die Skala ueber die
mannigfachsten Schattierungen hinweg bis hin zu „es f a n d . . . keine ungeteilt begeisterte Aufnahme, da die Darstellung reichlich primitiv war und der Inhalt des
Spieles kaum eine Beziehung zur gegenwärtigen Diasporasituation der evangelischen Christenheit in D e u t s c h l a n d . . . enthielt." Es w a r vielleicht so, dass wir dort,
wo man unseren Besuch so verstanden hatte, wie er sein wollte, besonders herzlich dankbar und unvoreingenommen aufgenommen wurden, aber dort, wo keine
persönlichen Beziehungen bestanden hatten und m a n besondere Erwartungen und
Absichten an uns knuepfte, um vielleicht ein Entscheidungsmoment zu erzielen,
eine Abkuehlung und Enttäuschung auf beiden Seiten auftrat. Unsere Jugend
spürte sehr schnell, dass man sie irgendwie bevormunden wollte und zog sich
dann in sich selbst zurueck und blieb unter sich. Dadurch war sie dann auch rein
äusserlich bei ihren Darbietungen, ihrer Mentalität entsprechend, gehemmt. Man
durfte ja nicht aus den Augen lassen, dass die Teilnehmer dieser Guten-WillensReise weithin einfache junge Leute aus landwirtschaftlichen und gewerbetreibenden Kreisen waren, die von irgendeinem abgelegenem Fundo in der Weite ihres
Heimatlandes oder vom Ladentisch kamen und nun in die f ü r sie bisher unvorstellbar grosse und pulsierende Welt versetzt wurden. Das zu verkraften, kostete
besonders zu Anfang ein schönes Stueck Herzblut und f u e h r t e zu manchen Spannungen .
J e länger aber die Reise währte, umso ausgeglichener wurde die Gruppe und
umso warmherziger ihr Vertrauen den Gastgebern gegenueber. Wie stark im Allgemeinen doch der Eindruck unseres Besuches bei den Gemeinden war, mag daraus ersichtlich sein, dass uns d a f u e r schon druebeni und nun auch nach der Rueckkehr eine reichhaltige Fuelle von Dankesbezeugungen erreicht hat. Dabei ist des
öfteren betont wordn, dass seit unserem Gemeindebesuch der Gottesdienstbesuch
und das Gemeindeleben wesentlich stärker geworden sei, sodass durch Gottes Führ u n g aus der erfolgten Begegnung ein gegenseitiger Segen erwachsen durfte. Für
uns liegt da zweifelsohne die Verpflichtung ob, mit den Gemeinden durch Gebet
und Schriftverkehr in lebendiger Verbindung zu bleiben.
Es braucht wohl k a u m sonderlich vermerkt zu werden, dass die Gruppe auch
90
offiziell an allen Veranstaltungen des öffentlichen Lebens und der Gemeinden
teilnahm wie am Erntedankfest, Reformationstag, Volkstrauertag, Ewigkeitssonntag, Tag der Inneren Mission und was sonst zu nennen sei. Den grössten Eindruck
aber hinterliess ganz zweifellos das erstmalige Erlebnis von Weihnachten in
Deutschland und der gesamten Adventszeit vorher.
Vielgestaltig sind nun all die Erlebnisse gewesen, die unsere Gruppe geschaut
und gesammelt hat. Da waren es zunächst die grossen und erhabenen Gotteshäuser und die kleinen und anmutigen Kirchlein im Schwarzwald, in Norddeutschland
und in Bayern, die mit grosser Verwunderung betrachtet wurden. Stanke Ablehnung dagegen fanden die modernen Kirchen, wie z. B. in Stuttgart-Korntal oder
Castrop-Rauxel, mit denen der Grösstteil der Teilnehmer einfach nicht fertig werden konnte. Selbst die warmherzigen und begeisterten Lobhymnen der Fuehrer
durch die Gotteshäuser vermochten nicht das geringste Verständnis oder eine leise
Zustimmung zu erreichen. Lediglich ein ganz kleiner Prozentsatz der Gruppe liess
sich mit der Zeit f u e r eine positivere Wertung und Anerkennung f u e r die neuen
Stilformen aufschliessen. Uneingeschränkt bewundert wurden indessen die Dome
und Kirchen in den klassischen Baustilen. Sie wurden mit Aufmerksamkeit und
Verehrung besichtigt und ihre Kunstwerke wurden sehr eingehend studiert und
wo es möglich war, in irgendeiner Form als bleibende Erinnerung mit nach Haus
genommen. Der Leiter der Gruppe hat sich immer wieder ueber diese Aufgeschlossenheit der Teilnehmer gefreut und konnte dabei manch gutes und belehrendes Wort anknuepfen. In tiefer Andacht und Ergriffenheit nahmen wohl alle
Teilnehmer die herrlichen Orgelmusiken auf, wo sie uns geboten wurden oder wir
zu ihnen eilten, so weit es unsere eigenen Verpflichtungen zuliessen. Eine solche
Klangfuelle eines Instrumentes und die oft ueberragend gute Meisterung durch
die vortrefflichen Organisten liess sie erschauern, da ihnen bisher auch nicht die
beste Wiedergabe einer Schallplatte mit Orgelmusik einen solchen Eindruck und
ein solches Erlebnis vermitteln konnte. Die gleiche ueberwältigende Ergriffenheit
liess sich bei dem Vernehmen der Glocken beobachten, oder wenn wir Gelegenheit
hatten, ein seltenes Glookenspiel zu hören. Von Chile her ist den meisten Teilnehmern nur ein duennes, ängstliches Läuten einer einzelnen Glocke bekannt, und
auch die hier zu Lande beachtlichen Geläute der meisten Kirchen unserer Synode
erschienen ihnen im Vergleich zu drüben wie der unvollkommene Versuch einer
bisher nicht geahnten Fuelle.
Eine starke und fast durchweg uneingeschränkte Ablehnung fand bei allen
Mitreisenden die Liturgie in den lutherischen Landeskirchen, und auch dort gab
m a n sein Befremden darueber zum Ausdruck, wo die neuen liturgischen Formen
eingefuehrt worden waren. Hierueber gab es f u e r sie keine Diskussion, und jeder
Versuch, sich doch einmal wohlwollend und verständnisvoll in die Form hineinzudenken und hineinzuleben, fand radikale Zurueckweisung.
Was den Gottesdienstbesuch selbst und die aktive Teilnahme der Gemeinde
am Gottesdienst anbetraf, so hatte die Gruppe auf ihrer grossen Reise, die sie
zweimal durch Deutschland fuehrte, reichlich Gelegenheit, ihre Beobachtungen zu
machen. Und auch hier wurde gut geschaut und scharf kritisiert. Dabei ging das
eindeutige Urteil dahin, dass grundsätzlich der Besuch und die Lebendigkeit und
Aufgeschlossenheit der Gemeinde im Gottesdienst im Sueden reger ist als in
91
Norddeutschland. Aber bei dieser Beurteilung ist weiterhin die Feststellung getroffen worden und bemerkenswert, dass der Gottesdienstbesuch überall im
Allgemeinen in Bezug auf die Grösse der Gemeinden als recht schwach beurteilt
werden muesse: „Es ist mir aufgefallen, dass der Kirchgang f u e r den Normalchristen recht wenig bedeutet, obwohl er sich Christ nennt und zur Kirche gehört. Mit
eigenen Augen konnte ich mich davon ueberzeugen, dass die Teilnehmer am Gottesdienst in den einzelnen Gemeinden, obwohl sie zahlenmässig recht gross sind,
auffallend wenig sind." Solche und ähnliche Urteile sind auf der Reise öfter gefallen. Dabei verschlossen die jungen Leute ihre Augen durchaus nicht vor der
allenthalben beobachteten Mitarbeit bewusster Christen! in der Kirche. Dies liess
sich sowohl im Norden wie im Sueden beobachten, wobei aber auch wiederum der
Anteil der Mitarbeiter im suedlichen Raum grösser erschien. Beachtet und mit
Erstaunen anerkannt wurden die vielen verschiedenen Arbeitskreise von der Männerarbeit bis hin zum Missionsnähverein, vom Posaunenchor bis zu den Kinderkrippen. Eine solche Vielfalt der Aeusserung des kirchlichen Lebens liesse sich
bei der Kleinheit unserer Gemeinden und bei der Zerstreuung ueber grosse Gebiete garnicht ermöglichen. Aber der Verdacht wurde immer wieder sehr ernsthaft
geäussert und kam eigentlich nie recht zum Verstummen, ob sich nicht vielfach
diese Kreise in eine Art Selbstgefälligkeit hineinsteigern und ihr Eigenleben zu
fuehren trachten, wie denn immer wieder Fälle auftraten, wo diese Kreise z. B.
ueberhaupt nichts von dem Dasein unserer Gruppe in der Gemeinde wussten, obwohl wir zur gleichen Zeit unter demselben Dach eines beachtlichen Gemeindehauses vor Hunderten unseren Gruss an die Gemeinde ueberbrachten.
In Erstaunen und in freimuetige Anerkennung ueber so viel Zweokmässigkeitssinn versetzten immer wieder die kirchlichen Zentren, von denen wohl u. a.
das Dominikanerkloster in F r a n k f u r t , die Kreuakirche in Wiesbaden und ein Gemeindehaus in Berlin-Friedenau die beachtenswertesten waren, die wir ganz speziell schauen, benutzen und sogar in F r a n k f u r t bewohnen durften. Doch unsere
Teilnehmer glaubten darin nicht unbedingt ein Zeugnis f u e r die Lebendigmachung
und Aufgeschlossenheit der Gemeinde zu erblicken, sondern äusserten bei afier
Bewunderung ueber diese Zweckbauten ihre Ansicht dahin, dass sie durchaus die
Gefahr einer Stagnation in sich schlössen. Immer wieder ging hartnäckig ihre
F r a g e besonders an die Quartiergeber, wie es denn mit der tatsächlichen Gemeinde bei regelmässigen Zusammenkuenften in diesen wunderschönen und beispielhaft zweckmässig errichteten Bauten stuende.
-Es ist ja klar, dass bei den kurzen Besuchen niemals ein erschöpfender Ueberbliok ueber das jeweilige Gemeindeleben erzielt werden konnte. Aber wach waren
unsere Leute stets und ueberall da, wo sie mit Menschen in Beruehrung kamen!
Dabei wurde sofort und unablässig versucht, durch Frage und Antwort ein möglichst umfassendes und wirklichkeitsgetreues Bild zu bekommen und anschliessend wurde von einigen das Gehörte und Geschaute im Reisetagebuch mit der eigenen Stellungnahme fixiert. Das sollte ja auch auf der Reise erzielt werden, und
a u s diesem Grunde war die Gruppe so ausgewählt und zusammengestellt worden,
dass sie solche Menschen in einem Alter umfasste, die sich f u e r eine derartige Begegnung besonders aufnahmebereit und aufnahmefähig erweisen wuerden.
Schon die Aufnahme in die Familien unserer gastgebenden Gemeinden lieferte
92
die Gewähr dafuer, dass jedes Glied der Gruppe im L a u f e der Zeit mit einem
grossen Kreis von Menschen aus den verschiedensten Lebens- und Berufsgruppen
zusammenkam, die ihrerseits nun dazu beitrugen, dass die Gäste ihre Verwandten,
Freunde und Bekannten kennenlernten. Die Gastgeber taten dabei bis auf ganz
verschwindend wenige Ausnahmen alles erdenkbar Mögliche, um ihren Gästen aus
dem fernen Südamerika, denen sie sich durch den gemeinsamen Glauben, durch
das Bekenntnis unserer Kirche und durch die noch heute hier in Chile in den Kirchen, in den deutschen Schulen und in den Familien gepflegte deutsche Sprache
verbunden fuehlten, den Aufenthalt so angenehm und w a r m zu machen, wie es
n u r gehen konnte. Dieses weitgehende Entgegenkommen und, die grosse Aufopferungsbereitschaft der gastgebenden Familien bis hin zum Verzicht auf ihre eigene Schlafstätte muss ganz offenherzig herausgestellt werden. Dies wirkte auf unsere jungen Leute wie ein Wunder, da ihnen weithin vorausgesagt war, dass man
derartige Zuege, wie sie hierzulande täglich geuebt werden, bei dem heutigen europäischen Menschen und seinen Verhältnissen nicht antreffen wuerde. Dabei war
es natuerlich nicht immer leicht, die Lebensform des jungen Chilenen, der aus einem Lande mit ganz anderen Lebensgewohnheiten kommt und die Art, wie eine
geordnete deutsche Familie lebt, in Einklang zu bringen. Das zeigte sich neben
einer Reihe von anderen Erscheinungen besonders dort, wo es um die Frage der
Zeit ging. Die Gäste konnten nirgends mit der ausgesprochenen Puenktlichkeit
fertig werden, die allueberall in Deutschland herrscht und eine grundsätzliche
Charaktereigenschaft des Menschen ist, und es bedurfte sehr ernsthafter Anstrengungen und steter geduldiger Ermahnungen, um hier nicht in die Gefahr eines
ernsthaften Schadens f u e r unsere Gesamtreise zu kommen. Das steigerte sich bis
zu der vielleicht etwas zugespitzten, aber doch irgendwie ehrlichen Aeusserung,
dass „in Deutschland alles schön gewesen sei, nur die uebertriebene Puenktlichkeit wäre nicht zu ertragen gewesen."
Völlig neu w a r f u e r die jungen Menschen das Fernsehen. Ihm wurde mit grosser E r w a r t u n g entgegengesehen und es wurde mit wechselvollem Interesse angeschaut, öffnete es uns j a selbst so viele Male sein Studio oder kam zu unseren Veranstaltungen. Aber die Gefahr f u e r das Familienleben und fuer die heranwachsende Jugend wurde bei dem sehr lebendigen Familiensinn unserer Leute sehr
offen konstatiert.
Sehr eigenartig wurde auch die uebertriebene Tierliebe f u e r Hunde aller Rassen und Unrassen empfunden und einer scharfen Kritik bis hin zu einem Anflug
bitteren Spottes unterzogen.
Die Wohnverhältnisse in den Neubauwohnungen, wie ueberhaupt der grosse
Aufbauwille auf allen Gebieten gaben zu einer uneingeschränkten Bewunderung
Anlass. Man kam dabei aus dem ehrlichen Staunen garnicht heraus, wie es denn
möglich sei, dass all die hier so begehrten und unerschwinglichen Gegenstände bis
'hin in die einfachsten Arbeiter- und Fluechtlingswohnungen als ganz selbstverständlich anzutreffen waren. Dazu kam die unuebersehbare Zahl von Autos letzten Jahrganges auf — f u e r suedamerikanische Verhältnisse — unvorstellbar hervorragenden Strassen, die von Menschen gefahren wurden, die hier nie zu einem
Wagen kommen könnten und die herrlichen Möglichkeiten von Ferienreisen in
Autobussen, mit der Eisenbahn und im Flugzeug in f e r n e Länder zu spottbilligen
93
Preisen, um nur einiges anschlagen zu lassen. Wohl verschloss man sich auch hier
nicht der Erkenntnis, dass darin eine grosse Gefahr aufkommt, immer neuere und
bessere Gueter zu besitzen, nie zufrieden zu sein, sodass der Mensch allmählich
wie von selbst zum Sklaven seiner Wuensche werden: kann und auch stellenweise
geworden ist.
Um dies alles zu erreichen, arbeiten oft Mann und F r a u und ueberlassen die
Kinder ihrem Schicksal, wenn sie schulpflichtig geworden sind. Fuer derartige Erscheinungen konnten die Mitreisenden keine Entschuldigung finden, wo immer
sie ihnen entgegentraten.
Von daher ist es vielleicht auch zu begreifen, dass gerade sie als junge Leute
ein besonders hartes Urteil über einen grossen Teil der deutschen Jugend fanden.
Sie kamen mit ihr bei den mannigfachsten Gelegenheiten zusammen und konnten
sich nicht enthalten, ihr oft ausgesprochene Schlaksigkeit und Überheblichkeit
vorzuwerfen, die an Herzenskälte grenzt. Es muss auch zuweilen in Gesprächen
über Fragen des Glaubens und der Moral diskutiert worden sein, wobei dann gewiss nicht aus Pharisäertum, sondern von der Lebensform ihres Heimatlandes her
recht scharfe Urteile gefallen sind. Man konnte es dabei kaum verstehen, dass dieselbe Jugend dann, wie auch sonst alle Menschen in Deutschland, von einem Arbeitseifer, einer Pflichterfüllung und einem Verantwortungsbewusstsein den sozialen Fragen gegenüber beherrscht ist, wie es dem Menschen aus Chile unbekannt ist. Doch wandte man sich in demselben Atemzuge gegen die dauernde Hetze und die Überarbeitungserscheinungen als Folgen eben dieses Eifers. Der Wohlstand wurde anerkannt und er ist mit einem fast neiderfüllten Blick auf die chilenischen Verhältnisse bewundert worden. Uneingeschränkt wurde auch mit aufrichtigem Lob die saubere und gewissenhafte Ausbildung und Leistung des Facharbeiters gerühmt, wobei ein Bedauern darüber mitschwang, dass dies im eigenen
Lande nie möglich werden könnte. Selbst dass die F r a u so gleichberechtigt in allen Berufsgattungen ihren vollen Platz auszufüllen versteht, ohne etwas von ihrer
Weiblichkeit und ihrer traditionellen Eleganz einzubüssen, fand allgemeine und
offenherzige Beachtung.
Diese positiven und negativen Beurteilungen des täglichen Lebens zu ergänzen, hatten wir oft genug Gelegenheit bei den Besuchen in grossen und auch kleinen Industriewerken, bei Einrichtungen des sozialen Lebens und durch Einladungen bei staatlichen und kommunalen Stellen. Wie wir die Ehre hatten, während
der Teilnahme an einer Bundestagssitzung von Herrn Bundeskanzler begrüsst zu
werden, so häuften sich die Empfänge beim Eintreffen in jeder Stadt. Auch der
Herr Bundestagspräsident hatte uns, zu sich geladen und wir bedauerten sehr,
seinem Ruf wegen langfristiger Verpflichtungen mit Fernsehaufnahmen nicht
Folge leisten zu können. Unermüdlich und sehr interessiert nahm die Gruppe alle
diese Einladungen und Besichtigungen entgegen, um die erstaunlichen Fortschritte der deutschen Industrie, die Ergebnisse des Wirtschaftslebens und die E r r u n genschaften der sozialen Verhältnisse zu studieren. Es verschlug allen oft den
Atem, was sich da an beachtenswerten Ergebnissen bot. Doch wurde sehr bedauert, dass sich so viele Werke der chemischen Industrie gerade in der Rheinprovinz
befänden, die der Schönheit der Landschaft und dem gewinnenden Reiz der anmutigen Ortschaften weithin Abbruch täten. Endlich mag immerhin auch die bemer94
kenswerte Feststellung erwähnt werden, die auf der gesamten Reise immer wieder geäussert wurde, dass man trotz eifrigen Umschauens und emsigen Suchens
keine zerlumpt gekleideten Gestalten zu sehen bekam.
So gipfelte der Gesamteindruck über die wirtschaftliche und soziale Lage in
der Konstatierung, dass f ü r das deutsche Volk die Arbeit eine unumgängliche
Notwendigkeit sei und nicht als Verpflichtung (obligación) verstanden wird. Der
deutsche Mensch, so wie man ihn erlebte und sah, könne überhaupt nicht inaktiv
sein und erfülle seine Arbeit mit einer Betriebsamkeit und Begeisterung, die als
seine ausgeprägteste Eigenart erschien. Man meinte sogar, dann und wann so weit
gehen zu dürfen, dabei einen Unterton von religiöser Tendenz beobachtet zu haben. Dank dieser Charaktereigenschaft habe er eben nach einem Tiefstand sondergleichen, wie ihn selten ein Volk mit solcher Kultur und Tradition gehabt habe,
in kürzester Zeit einen Lebensstandart aufgerichtet, der höher ist, als ihn andere
Länder ringsherum aufweisen.
Ganz selbstverständlich fanden schliesslich auch die kulturellen Einrichtungen auf allen Gebieten eine uneingeschränkte Bewunderung. Wenn der Chilene
mit Recht darauf stolz ist, dass er f ü r sich in Anspruch nehmen darf, die besten
Universitäten und Schulen Südamerikas zu besitzen, so wurden die Teilnehmer
auf dieser Reise sehr bescheiden, aber zugleich des Lobes voll, wenn sie Gelegenheit hatten, die wirklich vorbildlichen und vielfältigst Einrichtungen von Fortbildungschulen, auch in Landgemeinden, bis hin zu neu erstellten Schulen und
Universitätsinstituten, zu besichtigen, ganz zu schweigen von den vielen Einrichtungen unserer Kirche. Sie wünschten sich selbst solche Möglichkeiten des Studiums und der Berufsausbildung. Hinzu kamen schliesslich die herrlichen Theater
mit sehr eindrucksvollen Aufführungen klassischer und moderner Werke. Dadurch ist fraglos ein besseres Verständnis f ü r die Bewahrung und Pflege des deutschen Kulturgutes und der deutschen Sprache durch die Schulen und die verschiedenen Institutionen der deutschen Gemeinschaften erwachsen.
Sehr beeindruckt waren die jungen Menschen durch den Besuch in Berlin.
Es darf wohl uneingeschränkt behauptet werden, dass f ü r sie diese Zeit überhaupt
der Höhepunkt der Reise war. Man nahm begierig den Wiederaufbau des westlichen Teiles der Stadt mit all den Errungenschaften der westlichen Zivilisation und
dem Willen zur freiheitlichen Unabhängigkeit wahr und war demgegenüber erschüttert über die katastrophalen und bitteren Zustände, die sich im Ostsektor
zeigen und die an der Grenze zur Zone sichtbar wurden. Im Harz hatten sie in der
Nähe von Hohegeiss nochmals einen sehr beredten und eindrücklichen Anschauungsunterricht über die widrigen Verhältnisse der gewaltsamen Spaltung Deutschlands erhalten, die durch den Eisernen Vorhang entstanden sind, die die Tragik
nicht nur Deutschlands, sondern g a n z Europas darstellen. Sie liessen trotz der sehr
beschränkten Zeit keine Gelegenheit vorübergehen, die politischen Verhältnisse
zu studieren, die durch den Ausgang des letzten Krieges über das Heimatland ihrer
Väter gekommen sind.
Mit besonderer Genugtuung konnte die Gruppe ausserdem überall ein grosses
Verständnis f ü r die Belange und Verhältnisse ihrer eigenen Heimat beobachten.
Diese Anteilnahme an Chile war nicht erst durch das schwere Erdbeben des Jahres 1960 entstanden, über das nicht oft und intensiv genug berichtet werden muss95
te, sondern hat viel tiefere Wurzeln, die weit in die Vergangenheit reichen. Man
weiss ziemlich gut darüber Bescheid, welche freundschaftlichen Gefühle Chile f ü r
Deutschland hegt und dass Chile in schwerster Zeit gerade durch das Hilfswerk
der Kirchen ungeheure Hilfen geschickt hatte. E s wurde daher bei allen nur erdenklichen Gelegenheiten immer wieder betont, dass Chile der beste Freund
Deutschlands sei und dass nun die Bundesrepublik diese Freundschaft durch ihre
grosszügige und konstruktive Hilfe erwidert, woran sich alle Bevölkerungskreise
ganz selbstverständlich beteiligen. Die Glieder unserer Kirche aber wollen darüber
hinaus durch ihre Gaben f ü r das Hilfswerk f ü r Chile den kirchlichen Aufbau weithin unterstützen und die soziale Arbeit fördern. So ergab es sich wie von selbst,
dass die Gruppe bei jeder Möglichkeit die Gelegenheit ergriff, allen Menschen den
aufrichtigen Dank für die beispielhaften Hilfen nach der Katastrophe zum Ausdruck zu bringen, sei es nun bei den offiziellen Empfängen, in der Presse, im
Rundfunk oder beim Fernsehen und nicht zuletzt auch bei den Darbietungen.
So durfte wohl diese erstmalige Reise einer kirchlichen Gruppe aus den Evangelisch-Lutherischen Gemeinden Chiles über den Rahmen ihrer ursprünglichen
Absicht hinaus ein sichtbares Band dafür gewesen sein, wie eng sich die Menschen
hier in Chile, selbst in ihrer Jugend, noch immer dem Land ihrer Väter verbunden
wissen. In herzlicher Liebe stehen sie zu dem Mutterland ihres Glaubens, den sie
über Generationen treu bewahrt haben und weitertragen wollen. Es war ganz
gewiss nicht nur die überwältigende Gastfreundschaft und die rührende Aufmerksamkeit, die überall den Besuchern entgegengebracht wurde, sondern eine offenherzige Zuneigung zu den Menschen gleichen Glaubens und gleichen Bekenntnisses, die uns diese Reise so angenehm und wertvoll gemacht hat. D a f ü r kann nur
ein aufrichtiger Dank empfunden werden. Dabei möchte man bedenken, dass dieser
Besuch aus den zahlreichen Zusendungen von kirchlichen Zeitungen und Zeitschriften im Dienst der Schriftenmission f ü r Temuco erwachsen war und so durch
Gottes Führung und F ü g u n g zu einer Begegnung mit vielen Brüdern und Schwestern in der Heimatkirche geworden ist.
Mit dem Willen und dem Gelöbnis, fernerhin füreinander zu beten, klang jeder Besuch in den Gemeinden in Nord und Süd, in West und in Berlin aus. Da und
dort gaben auch die Posaunenklänge der Jungen Gemeinde bei der Abfahrt das
Weggeleit. Diese entstandenen Begegnungen aber möchten f ü r alle Teilnehmer
eine Anregung dafür geworden sein, über die persönlich geknüpften Verbindungen
hinaus sich nach der Rückkehr stärker in den Dienst ihrer Heimatgemeinden zu
stellen. Nachdem erkannt worden ist welchen herzlichen und weiten Bogen unsere
Kirche in der Gemeinschaft Unseres Herrn Jesus Christus schlagen kann, dürfte
es leicht und innerlich gewinnbringend zugleich sein, diese Kirche lieb zu haben
und f ü r sie da zu sein. Die Losung des Gustav Adolf-Werkes aber, dessen Fürsorge wir mit dem Kirchlichen Aussenamt, dem CVJM und all den anderen Werken
unserer Kirche überall drüben empfanden, möchte im Galater 6, 10 durch diese
Reise von neuem wahr werden und wechselseitig über die Kontinente hinweg der
weiteren Erfüllung harren.
96
Dr. JUAN HEPF DUBIAU — Santiago
Soziale Fürsorge, eine ethische Pflicht der christlichen
Gemeinden in Chile
Unter der Vorherrschaft der nationalstaatlichen Machtrivalitäten und Monopolbestrebungen der letzten J a h r h u n d e r t e ist eine friedliche D u r c h d r i n g u n g der
Erde mit wirtschaftlichen und sozial fortschrittlichen Ideen und P r a k t i k e n nicht
erfolgt, sondern ist u m g e k e h r t versucht worden, eine 'Situation extremer w i r t schaftlicher, gesellschaftlicher und politischer Ungleichheit zwischen einer w e s t lichen Minderheit und einer nichtwestlichen Mehrheit zu verewigen.
Die wirtschaftliche und soziale Durchdringung der Kolonialgebiete und der
unterentwickelten Länder seitens der westlichen Welt, h a t selten Rücksicht g e nommen auf die Eigentümlichkeiten des sozialen Gefüges dieser Gebiete, ihre
Differenzierung, A u f n a h m e f ä h i g k e i t und Bereitschaft f ü r diese auf den Westen
angepassten wirtschaftlichen und sozialen Formen.
Hierdurch begrenzte das christliche Abendland selbst den Bereich seiner p o sitiven Auswirkungen in einer f ü r seine eigene Z u k u n f t gefährlichen Weise. In
jenen Ländern, in denen bereits der iDruck der sozialen und wirtschaftlichen Missstände zu Umwälzungen wie in Mexiko, Cuba und Bolivien g e f ü h r t hat, werden die
Kirchen von den Volksmassen als „reaktionär" e m p f u n d e n .
Die krassen Ungleichheiten der Einkommenverteilung zwischen den Völkern
und Kulturkreisen kann an Hand weniger aber typischer Daten gezeigt werden:
Die Einwohner Nordamerikas (der U. S. A. und Kanadas) stellen 6,9% der
Erdbevölkerung dar und beziehen 42,9% ihres Einkommens; diejenigen Lateinamerikas, ungefähr gleich an Zahl, beziehen nur ein Zehntel. Wenn man ausser
Nordamerika auch gan2 Europa westlich der Sowjetunion und alle Gebiete Ozeaniens in das „westliche christliche Abendland" einbezieht, ergibt sich, dass die
Mitglieder dieses Kulturkreises rund 24% der Menschheit ausmachen und 70,8%
ihres Einkommens beziehen.
Trotz bedeutsamer Verbesserung im Gesundheitswesen auch vieler unterentwickelter Länder beträgt die durchschnittliche Lebenserwartung toei der Geburt
in vielen Gebieten Asiens, Afrikas und Lateinamerikas gegenwärtig nur rund die
Hälfte derjenigen in Ländern Westeuropas und Nordamerikas, während die
Säuglingssterblichkeit u n g e f ä h r doppelt sc hoch ist. Nach Feststellungen der FAO
leiden etwa zwei Dritte] der Menschheit unter ungenügender E r n ä h r u n g , und
dieser Prozentsatz ist vorläufig noch im Zunehmen begriffen wegen des a u s s e r 97
ordentlich schnellen Wachstums der Bevölkerung materiell
zurückgebliebener
Gebiete, Hingegen weisen gleichzeitig viele Länder der westlichen Welt anhaltende landwirtschaftliche Überproduktion auf.
Zweifellos stehen wix heute einer Revolution .gegenüber, die tatsächlich das
Überleben unserer westlichen Zivilisation in Frage stellt. Sie ist die Erhebung der
politisch, gesellschaftlich und materiell zurückgebliebenen Völker.
Wenn wir die Länder der Welt in drei grosse Gruppen einteilen: die kapitalistischen Länder, die kommunistischen Länder
und
die Entwicklungsländer
(hierzu auch Chile) ergibt sich, dass der erste Block heute 0,77 Mrd. Menschen
hat, während die kommunistischen Länder zusammen fast 1 Mrd. Menschen a u f weisen. Die Entwicklungsländer zählen gegenwärtig eine Bevölkerung von 1 Mrd.
Menschen.
Im Jahre 2000 (also in nicht ganz 40 Jahren) werden ungefähr 2,5 Mrd. Menschen in den heute kommunistischen Ländern, 2,5 Mrd. in den Entwicklungsländern
und nur 1,2 Mrd. Menschen in den kapitalistischen Ländern leben.
Wenn nun die Entwicklungsländer, durch Versagen der reichen westlichen
Industrieländer oder ihrer, eigenen führenden geistigen Schichten,
gezwungen
würden, sich irgendwann im Laufe der Jahrzehnte bis zur Jahrtausendwende den
kommunistischen Ländern anzuschliessen, so hätten wir um das J a h r 2000 eine
Welt mit 5 Mrd. Kommunisten und 1,2 Mrd. Nichtkommunisten vor uns.
Die Lösung heisst also: westliche Hilfe und Beratung f ü r die Entwicklungsländer, und zwar in so ausreichendem Masse, dass einer solchen bedrohlichen
Entwicklung in den nächsten Jahrzehnten vorgebeugt wird.
Hieraus erwächst aus Selbsterhaltungstrieb den führenden wirtschaftlichen
Kreisen des westlichen Abendlandes eine erste Pflicht, die nationalstaatlichen
Machtrivalitäten und Monopolbestrebungen einzustellen und die christlichen Inhalte ihrer Kultur im vollem Ausmasse den Entwicklungsländern zu Gute kommen zu lassen. In anderen Worten: die soziale Fürsorge und wirtschaftliche Hebung der Bevölkerung der unterentwickelten Länder ist ein hochaktuelles Gebot
geworden.
Dei moderne, technische und wirtschaftliche Fortschi itt — ohne entsprechende soziale Fürsorge — hat die Entwicklung dieser Völker nicht so sehr gefördert, sondern nur ihre Desorientierung und Entwurzelung vergrössert und so ist
durch westlichen Einfluss das städtische Proletariat entstanden, das heute zur
kommunistischen Weltauffassung drängt.
Auch Chile gehört zu den Entwicklungsländern, dessen Orientierung zur
westlich-abendländischen Welt oder zum kommunistischen Block auf dem Spiele
steht. Diese Entscheidung kann uns nicht gleichgültig sein, und es ist eine der
grossen Verantwortungen unserer Generation, diese Sachlage richtig zu erkennen
und entsprechend zu handeln.
Wir können nicht erwarten, dass sämtliche Massnahmen wirtschaftlicher Art,
allein von den Westmächten getroffen und durchgeführt werden, eine aktive Beteiligung und Besetzung dieser wirtschaftlichen Massnahmen mit christlichen
Inhalten ist unerlässlich, sollen sie sich überhaupt fruchtbringend auswirken.
Die menschenunwürdigen Wohn-, Lohn- und Lebensverhältnisse der breiten
Masse unseres Volkes müssen ehestens aufgebessert werden. Als erste Aufgabe
98
stellt sich uns die soziale Fürsorge mit all den Massnahmen, die der Versorgung
der Mütter, Kinder, Festigung der Ehen, Gestaltung des Heimes, menschen würdige Arbeitsmöglichkeit und Belohnung, Versorgung der Waisen, Witwen, Invaliden und Gebrechlichen dienen, die das Leid und die Not der Bevölkerung mindern, aus der der kommunistische Block seine Anhänger rekrutiert.
Es ist dies eine Aufgabe, die nicht nur den Staat, das Gesundheitswesen und
die Wohlfahrtsinstitutionen angeht, sondern die Sorge und Pflicht eines jeden
Betriebsleiters und verantwortungsbewussten Menschen sein sollte.
Wir dürfen uns nicht der Tatsache verschliessen, dass heute die notleidende
Bevölkerung im Kommunismus die Erlösung und Rettung erblickt und dass das
Christentum, mit dem Kapitalismus identifiziert, nicht mehr die dynamische Zugk r a f t auf die Volksmassen ausübt, nicht mehr die erhoffte erlösende Heilsbotschaft bedeutet. Fraglos halben die christlichen Gemeinden und Kirchen trotz angewandter Mühe und Arbeit bislang keinen durchschlagenden Erfolg gezeitigt
und ist dieses Versagen auf das passive, kontemplative Verhalten des Einzelnen
zurückzuführen.
Soll die grosse wirtschaftliche Hilfe und Beratung der westlichen kapitalistischen Welt für diese Entwicklungsländer überhaupt einen Sinn haben, so müssen gleichzeitig in diesen Ländern die geistigen Kräfte der christlichen verantwortungsbewussten Bestandteile des Bürgertums gelöst werden in einer grossartigen Aktion sozialer Fürsorge, an der jeder Einzelne sich voll einzusetzen hat.
2/3 unserer Bevölkerung ist unterernährt, z. T. mangelhaft oder einseitig
ernährt, jedes sechste Kind, das geboren wird, stirbt vor Jahresfrist, in ländlichen Bezirken sogar jedes f ü n f t e Kind. Chile ist das viert-teuerste Land der Welt
und weist eine der niedrigsten Durchschnittsbelohnung des Arbeiters auf. Die Unerträglichkeit der Wohnverhältnisse ist hinreichend bekannt: bei einer Bevölkerungszunahme von rund 200 bis 250,000 Menschen im Jahr, müssten jährlich
40 bis 50.000 neue Behausungen gebaut werden! Die Leistungen der letzten Jahre
sind, anerkennnenswert aber nur ein Tropfen auf dem heissen Stein. Hohe Allgemeinsterblichkeit, bei niedriger
Durchschnittslebensaussicht,
Analphabetismus
oder unzureichende Schulung, früh- und vorzeitiges Arbeiten — Kinder von 8, 10
und 12 Jahren in ländlichen Bezirken müssen sich ihr Leben verdienen — sind
Tatsachen, zu denen ein jeder von uns Stellung zu nehmen hat.
Auch unserer evangelischen Kirche in Chile und den wirtschaftlich wohlgestellten Gemeinden erwächst aus diesem Bewusstsein und Wissen heraus die Verantwortung der aktiver Anteilnahme an dem Aufbau einer Gesellschaft, in der
alle sozialen Schichten des Volkes friedlich beieinander leben: durch Bereitschaft
zum Opfer von Bestandteilen eigener Güter und durch ein ständiges Eintreten
für die Gerechtigkeit.
Ein Überblick der Leistungen evangelischer Gemeinden in sozialer Fürsorge
in unserer Heimat — sei es in Errichtung oder Erhaltung von Waisen- und Altersheimen, Krankenhäusern, Schulen, sei es im persönlichen Verhalten und im
Einsatz zu Gunsten besserer Wohn-, Lohn- und Arbeitsmöglichkeiten nicht nur
für ihre Mitglieder, sondern darüber hinaus f ü r die gesamte notleidende Bevölkerung — lässt uns klar erkennen, wie weit wir noch von diesen Zielen entfernt
sind.
99
Wie auf der ganzem Welt, so auch bei uns halben die christlichen Kirchen
und Gemeinden auf dieses vornehmlichste Arbeitsgebiet der Gemeinden hingewiesen und den einzelnen angeregt, bestimmend mitzuwirken. Die soziale Fürsorge
ist eine ethische Pflicht des christlichen Menschen heute und hat sich nicht n u r
auf die Mitglieder unserer evangelischen Gemeinde zu beschränken, sondern zum
Wohle aller Bestandteile unseres Volkes im breitestem Ausmasse zu verwirklichen.
Möge ein jeder, bevor das Schicksal an seiner Tür pocht, mit seinem Gewissen ausmachen in welchem Masse er diesem Ruf nachgekommen ist, und dabei
beherzigen:
„es ist später, als Du denkst!"
100
HANS-JOACHIM LAKUS — Santiago/Chile
Evangelische Sozialarbeit in Chile
Das Thema mag vielleicht im ersten Augenblick überraschen
denn gerade
in einem Lande wie Chile neigt man zu der Annahme, dass die soziale Arbeit von
den staatlichen oder gewerkschaftlichen Einrichtungen, oder von der kath. Kirche
wahrgenommen wird. Dass auch die evangelischen Kirchen und Gemeinden bereits
einen wesentlichen Beitrag zur sozialen Sicherung und Gesundung des chilenischen
Volkes leisten, ist allgemein wenig bekannt. Die Erkenntnis, dass die evang. Kirchen in Chile ihren sozialen Beitrag zu übernehmen haben, wenn sie nicht an ihrem Verkündigungsauftrag überhaupt vorbeigehen wollen, ist gerade in den Jahren nach dem aweiten Weltkriege stark gewachsen.
Evangelische Sozialarbeit oder Liebesarbeit heisst ja nichts anderes, als getrieben von der Liebe Christi dem notleidenden Mensehenbruder zu helfen. So wie
es Wichern oder Gustav Werner und die anderen Väter der Inneren Mission in
Deutschland einst taten. Es ist nicht in erster Linie eine humane, eine ethische
oder sozialpolitische Frage und Notwendigkeit, sondern der tiefste Grund ist die
Liebe Christi, die solches Tun erheischt. Darin unterscheidet sich das Motiv echter
evangelischer Liebestätigkeit oder Sozialarbeit, grundlegend von dem des Staates vielleicht auch von der Theorie, die das Vollbringen guter Werke zur Auflage
macht.
So wie die Not sich auf mannigfache Weise und in vielerlei Gestalt darstellt,
so soll und muss die Hilfe auf alle nur denkbare und mögliche Weise ihr zu begegnen suchen. Wir brauchen diese Not gerade in Chile, wie auch in allen anderen südamerikanischen Staaten, gewiss nicht lange zu suchen. — Sie begegnet uns
täglich und stündlich und immer, eigentlich sollte sie uns garnicht ruhig
schlafen lassen. — Es ist die Erziehungsnot, die Krankheitsnot, die Not der Alten
und Unversorgten, die Not der Krüppel und der Obdachlosen, die Not der Elendsbehausungen und nicht zuletzt der Hunger. — Es ist eine Not, die so riesengross
ist, die so tief wurzelt, dass auch die vereinten Bemühungen des Staates, der privaten Organisationen und der Kirchen aller Konfessionen sie nicht bannen können Diese Erkenntnis bedeutet keineswegs Kapitulation und Verzagtheit, sondern
gebietet Verdoppelung der Bemühungen und Anstrengungen. Ausserdem sind wir
in Chile nicht alleine. Christen aus aller Welt und gerade auch evangelische Christen ¡halfen und helfen und werden dies weiter tun. Als Beispiel sei die Aktion
„Brot für die Welt" angeführt. Sie ist ein sichtbarer und unschätzbarer 'Beitrag der
101
evang. weltweiten Christenheit, und auch die evang. Sozialarbeit in Chile hat durch
diese Aktion bereits ihren guten Nutzen gehabt.
Auch die Deutsche Evangelische Lutherische Kirche in Chile, die mit ihren
rund 25.00C Gemeindegliedern in der Vergangenheit sich überwiegend auf die Erhaltung und Pflege des eigenen kirchlichen und gemeindlichen Lebens beschränkt
hat, beginnt zunehmend zu erkennen, dass auch sie aufgerufen ist, ihren wohlabgewogenen und möglichen Beitrag zur Linderung der sozialen Not der chilenischen Heimat zu leisten. — Ihre Mitarbeit in der Ayuda Cristiana Evangélica, in
den verschiedenen interevangelischen Gremien, wie auch die Förderung landwirtschaftlicher Ausbildungsstätten und sozialer Zentren geben davon Zeugnis. Ob sie
in der Zukunft nicht noch mit einer oder mehreren, in eigener Regie betriebenen,
Einrichtungen in Erscheinung treten sollte, kann der Überlegung anheim gestellt
bleiben.
Um einen Überblick über die jeweiligen sozialen Bemühungen der verschiedenen evangelischen Kirchen in Chile im einzelnen zu gewinnen, ist es sicherlich
nützlich, deren Anfang und Verbreitung, deren Möglichkeiten und gegenwärtige
Situation kurz darzustellen. Wir haben es in diesem Lande nun einmal nicht mit
einer traditionsgebundenen, jahrzehnte- oder jahrhundertelang gewachsenen, einheitlich geprägten evangelischen Kirche zu tun, sondern die protestantischen Kirchen der verschiedensten Richtungen, haben völlig unabhängig voneinander, ihre
kirchliche und gemeindliche Arbeit begonnen und aufgebaut.
Chile ist ja, wie ganz Lateinamerika, zunächst einmal ein katholisches Land
und die kath. Kirche w a r bis 1925 offiziell Staatskirche. Erst unter dem Vater des
jetzigen Präsidenten Alessandri haben sich Staat und kath. Kirche voneinander
gelöst. Die einzelnen protestantischen Kirchen waren jedoch bereits vorher toleriert, einer der unschätzbaren Aktivposten des chilenischen Nationalcharakters
schlechthin; die Toleranz dem Andersdenkenden gegenüber.
Vorwiegend waren es nordamerikanische Missionare und Seelsorger, die evangelisches Gedankengut auch in weite Kreise der chilenischen Bevölkerung getragen haben, Die deutschen evang. P f a r r e r sind nie als Missionare ins Land gekommen. Ihre Aufgabe und ihr Auftrag bestand darin, die deutschen evangelischen
Gemeinden, die sich vorwiegend aus Kolonisten und Siedlern, aus Kaufleuten und
Instruktoren zusammensetzten, zu sammeln, zu versehen und in der deutschen
Muttersprache zu betreuen. Sc ist es zu verstehen, dass die Deutsche Evang. Luth.
Kirche in Chile, neben der englisch sprechenden Union Church, die einzige evangelische „Koloniekirche" neben den evangelischen Nationalkirchen Chiles ist.
Die Protestanten Chiles verteilen sich überwiegend auf die 10 nachfolgend
aufgeführten evang. Nationalkirchen:
1. Die Iglesia pentecostai nacional
2. Die Iglesia metodista
3. Die Iglesia presbiteriana
4. Die Iglesia Bautista
5. Die Iglesia de Dios
6. Die Iglesia Asamblea de Dios
7. Die Iglesia Foursquare
8. Die Iglesia Unión de Centros Bíblicos
102
9. Die Iglesia Alianza Cristiana y Misión
10. Die Iglesia Misión Anglicana
Die grösste und in der chilenischen Bevölkerung am meisten verbreitetste evangelische Kirche ist die Iglesia pentecostal nacional. Die Zahl ihrer Gemeindeglieder wird mit mehr als 300.000 angegeben. Sie unterteilt sich wiederum in 6 Hauptkirchen, die aber in einem Conzilium zusammengefasst arbeiten. Diese Hauptgruppen sind:
a) Die Iglesia Metodista Pentecosta) de Chile, mit mindestens 15.000 Mitgliedern
b) Die Iglesia Evangélica Pentecostal de Chile,
c) Die Iglesia Pentecostal de Chile,
d) Die Iglesia de Dios Pentecostal de Chile,
e) Die Misión Iglesia Pentecostal de Chile,
i ) Die Corporación Evangélica Pentecostal de Chile.
Alle vorgenannten 6 Hauptkirchen der Iglesia Pentecostal Nacional, haben
sich im Jahre 1909 von der amerikanischen Methodistenkirche entfernt und arbeiten völlig losgelöst und selbständig, ohne ausländische Missionare, nur mit und
unter Chilenen. Ihre soziale Liebesarbeit im Lande ist unterschiedlich. Einheitlich
tun alle 6 Kirchen Dienst in Krankenhäusern und in Gefängnissen. Einige Landschulen werden unterhalten und zwei Pentecostalkirchen haben Beerdigungsinstitute. Alle sammeln und verteilen Lebensmittel und Bekleidung an bedürftige Gemeindeglieder. — Die sozial am aktivsten wirksame Pentecostalkirche ist allem
nach die Misión Iglesia Pentecostal de Chile, die in Santiago eine Clínica Prenatal,
2 Altenheime und in Concepción ein Sozial-Zentrum in der Población Hualpencilla
in eigener Regie unterhält. Ausserdem bestehen verschiedene Bibelinstitute und
in vielen Städten Kurse f ü r erwachsene Analphabeten.
Die METHODISTENKIRCHE gehört zu den protestantischen Kirchen, die
schon vor der Jahrhundertwende in Chile gegründet wurden. 1893 kamen die ersten nordamerikanischen Missionare ins Land und gründeten hier ihre Gemeinden. Ihre Zahl wird zur Zeit mit etwa 8.000 eingetragenen Mitgliedern angegeben.
Die Bedeutung der Methodistenkirche in Chile lässt sich aber keineswegs hieran
ablesen, hingegen eher an der Zahl ihrer sozialen, erziehlichen oder gesundheitsfürsorgerischen Einrichtungen.
Nahezu 30 Schulen (Landschulen wie Oberschulen) mit 3.500 Schülern werden von den methodistischen Kirchen Chiles im Lande unterhalten. Die grössten
befinden sich in Santiago, Los Andes, Coquimbo und Concepción. Weitere in Punta
Arenas, Temuco und Iquique. In El Vergel (Angol) wird eine Berufsschule (30
Schüler) und eine Landwirtschaftsschule (70 Schüler) in eigener Regie betrieben
und unterhalten. Die Methodistenkirche besitzt bei El Vergel ein eigenes Gut (Fundo Angol), welches als Mustergut gilt und welches 250 Arbeitern und Angestellten
Heimstatt und Beschäftigung bietet.
In Santiago gehören die Clínica San Ramón und die Institución Sweet der Methodistenkirche an. Beide Einrichtungen leisten wertvolle gesundheitsfürsorgerische Hilfe gerade auch f ü r ärmere Bevölkerungsteile. Ebenfalls unterhält die Methodistenkirche in ihren Gemeindezentren Verteilstellen f ü r Bekleidung und Lebensmittel, die sie hauptsächlich von Ayuda Cristiana Evangélica erhält.
Ein Kinderheim in Santiago mit etwa 50 Plätzen wird von der Methodisten103
kirche getragen und ausserdem wurde jetzt am 10. Juni 1961 die Betreuung des
sozialen Zentrums in Valdivia begonnen. Dieses .Sozialzentrum ist in Zusammenarbeit mit Ayuda Cristiana Evangélica geschaffen worden und beginnt seine Arbeit mit einem Kindergarten, sowie einer Mütter- und Erziehungsberatung.
Das ebenfalls von der Methodistenkirche geführte Santiago-Colleg kann nicht
als soziale Äusserung dieser Kirche, hingegen als Erziehungseinrichtung von Bedeutung gewertet werden. Als englisch sprechende Schule wird es mit staatlichen
Mitteln der USA. subventioniert. (927 Schülerinnen).
Im ganzen darf man bei der Methodistenkirche Chiles den starken Eindruck
haben, dass sie der Not der chilenischen Bevölkerung, (nicht nur der eigenen
Gemeindeglieder) mit offenen Augen und mit offenen Herzen gegenübersteht.
Nicht unerwähnt soll der Umstand bleiben, dass sich die chilenische Methodistenkirche nicht nur der ideellen, sondern auch der materiellen Hilfe und Unterstützung ihrer Schwesternkirchen in USA. e r f r e u t ; wodurch jedoch keineswegs die
eigenen Bemühungen der chilenischen Methodistengemeinden
eine geringere
Würdigung zu e r f a h r e n haben.
Die PRESBITERIANISCHE KIRCHE ist zweifellos die älteste protestantische Nationalkirche Chiles. Ihre ersten Missionare seien bereits um 1840 aus
USA. nach Chile gekommen. Sie besitzt im Lande 30 eigene Kirchen und zählt
mehr wie 4.000 Mitglieder die persönlich eingeschrieben sind. — Die sozialen Bemühungen der Presbiterianer finden sichtbaren Niederschlag in ihren Institutionen und Schulen.
Das neue Sozialzentrum in der Población San Gregorio in Santiago, mit Kindergarten, Mütterbetreuung und Jugendarbeit, ist von der Presbiterianischen Kirche übernommen worden und wird von ihr betreut.
An weiteren Sozialeinrichtungen sind zu erwähnen, die Maternidad „Mutter
und Kind" in Santiago, ein Mädchenheim in Antofagasta <30 Plätze) und in Viña
del Mar die "Dispensario de Puericultura". Hier erhalten etwa 100 Kinder aus den
ärmsten Bevölkerungsschichten kostenlose, ärztliche Betreuung, Bäder, Lebensmittel und Bekleidung. Das Colegio „David Trumbull" in Valparaiso, gehört der
presbiterianischen Kirche, ausserdem 2 Grundschulen in Concepción und je eine
weitere in San Fernando, Viña del Mar, Vallenar und Yungay.
Die IGLESIA BAUTISTA, oder Baptistenkirche ist in ihren Anfängen von
deutschen ^Missionaren in Chile gegründet worden. Als erster Baptistenprediger
sei Oskar von Barchwitz nach Chile gekommen, der bald darauf deutsche Baptisten aus Hamburg und Berlin zur Auswanderung nach Chile ermunterte. In und
um Temuco herum entstanden die ersten Gemeinden (etwa 1890), die bald darauf
die entscheidende Missionshilfe aus den Vereinigten Staaten erhielten (1908). Bis
heute ist Temuco das Zentrum der Baptisten in Chile, dort befindet sich auch der
Sitz der sog. evang. Allianz. Die Zahl der Baptisten in Chile wird nach der letzten
Zusammenstellung mit 8050 angegeben.
Die Iglesia Bautista verfügt heute über eine Anzahl von Schulen, vor allem
im Süden des Landes, von denen das Colegio Bautista in Temuco die grösste ist.
Weitere befinden sich in Pucón, Villarrica, Carahue und an anderen kleineren
Orten. Als soziale Einrichtungen werden von den Baptisten in Chile eine Policlinico in Antofagasta und ein kleines Kinderheim in Temuco betrieben.
104
Die IGLESIA DE DIOS, gehört zu den sehr jungen und von daher auch sehr
kleinen prot. Nationalkirchen Chiles. Sie wurde erst vor 7 Jahren von 2 amerikanischen Missionaren gegründet und gibt die Zahl ihrer Glieder jetzt mit nahezu
2000 an. Kirchliche Gebäude gibt es bislang in Arica, Iquique, Antofagasta und
sieben in Santiago. Die soziale Tätigkeit beschränkt sich auf materielle, sowie
ideelle Hilfe und Unterstützung von Bewohnern der „poblaciones callampas", der
"casa nacional de) niño" und der Kranken in einigen Krankenanstalten. Eine Bibelschule mit 25 Internatsplätzen ist unlängst eingerichtet worden.
Die Iglesia ASAMBLEA DE M O S , ist ebenfalls eine der kleinen, erst 1953
von amerikanischen Missionaren gegründeten prot. Kirchen. Sie verfügt über
35 Kirchen in Chile und es gehören ihr etwa 3.000 Mitglieder an. Auch sie versieht ihren Evangelisationsdienst, aber auch den sozialen Dienst vorwiegend unter der ärmeren Bevölkerung in den Elendsvierteln (Poblaciones Callampas). Sie
hat einen Besuchsdienst in Krankenhäusern und in Gefängnissen eingerichtet und
verteilt Bekleidung und Lebensmittel, die sie ebenfalls von Ayuda Cristiana Evangélica erhält, an Bedürftige.
Ein Bibelseminar mit ebenfalls angeschlossenem Internat ist bislang die einzige geschlossene Anstalt der Iglesia Asamblea de Dios.
Die IGLESIA FOURSQUARE wurde erst 1950 von amerikanischen Missionaren in Chile gegründet. 1953 durch die chilenische Regierung anerkannt, verf ü g t sie heute über 31 Kirchen und Predigtstationen im Lande von Arica bis Pto.
Montt. Die Gesamtzahl der eingeschriebenen Mitglieder beträgt nahezu 2.000. —
Die Foursquare-Kirche unterhält eine Schule in Manquehue (Provinz Temuco)
und eine weitere f ü r 60 Indianerkinder in Lonquimay ¡(interior de Curacautin).
Weitere soziale Einrichtungen dieser Kirche gibt es bislang nicht.
Die IGLESIA UNION DE CENTROS BIBLICOS hat sich zusammengesetzt aus
einigen gleineren evang. Kirchen. Die "UNION" arbeitet hauptsächlich in den
Provinzen Cautín, Coquimbo und in Santiago. Im Süden hat sie sich hauptsächlich der Indianermission zugewandt. Sie betreibt 19 Schulen, hauptsächlich f ü r
Indianerkirchen, hat ein Bibelinstitut in Temuco und unterhält ein Dispensario
in Liquiñe bei Villarrica und ein weiteres in Mechuque (Prov. Chiloé).
Die Iglesia ALIANZA CRISTIANA Y MISION ist ebenfalls eine Vereinigung
kleinerer selbständiger Kirchen prot. Richtung. Es gehören ihr 9 Schulen im Süden des Landes zu und ebenfalls ein Bibelinstitut in Temuco.
Die MISION ANGLICANA ist der chilenische Zweig der anglikanischen Kirche Englands. Auch sie wendet sich in ihrer Arbeit hauptsächlich der Indianermission zu. Sie verfuegt über 15 Landschulen hauptsächlich bei Cholehol, ausserdem über ein Hospital und Dispensario in Cholehol, ein weiteres Dispensario in
Maquehue und über ein Bibelinstitut in Temuco.
Ausser den zehn vorgenannten Nationalkirchen
protestantischer Richtung,
gibt es in Chile freilich noch einige weitere, kleinere, eigenständige Kirchen, die
ebenfalls prot. geprägt, aber deren Bedeutung gering ist. Erwähnt soll noch die
"Iglesia del Señor" sein, die mit 3 Missionen im Süden und auch in Santiago eine
gewisse Verbreitung gefunden hat. Eine bemerkenswerte Verbreitung haben in
Chile ebenfalls die „Zeugen Jehovas", die „Adventisten" und die „Mormonen", die
105
als ausgesprochene Sekten im Rahmen dieses Berichtes keine Behandlung erfuhren.
Eine unschätzbar wertvolle soziale Arbeit unter persönlichem Einsatz aller
ihrer Glieder, leistet hier in Chile die Heilsarmee (Ejército de Salvación). Gewiss
haben ihre Begründer, als sie sich 1865 in England von der dortigen Methodistenkirche lösten, noch nicht an den helfenden Bruderdienst der „Armee Gottes" auf
dem südamerikanischen Kontinent gedacht. Aber dieser Dienst ist gerade jetzt
nötiger denn je. Wer würde sich wohl sonst in Chile des menschlichen „Strandgutes" annehmen?
Die Heilsarmee arbeitet hier seit 1909, zur Zeit mit etwa 80 Offizieren und
3.000 eingeschriebenen Mitgliedern. Es gibt 23 Hauptkirchen und 16 zum Teil beachtlich grosse soziale Institutionen.
Die grössten Einrichtungen sind die Heime f ü r obdachlose Männer in Santiago und Valparaiso mit je etwa 300 Betten. Weitere kleinere Obdachlosenheime
werden in Osorno, Valdivia, Antofagasta und Iquique unterhalten. Das Heim in
Concepción wurde durch das Erdbeben i960 zerstört. Frauenasyle gibt es in Santiago (6C Betten) und Valparaiso (50 Betten). Die Kinderheime der Heilsarmee
(Aurora 48 Betten, Llo-Lleo 52 Betten und El Alba 45 Betten), befinden sich alle
in der Nah¿ Santiagos. Ausserdem werden ebenfalls in Santiago 3 Kinderkrippen
unterhalten.
F ü r den Betrieb und die Aufrechterhaltung der Kinderheime erhält die Heilsarmee vom 'Staat einen kleinen Zuschuss, der aber auch nicht annähernd verglichen werden kann mit den Pflegesätzen, wie ihn kirchliche Einrichtungen in
Deutschland vom behördlichen „Kostenträger" erhalten. Die Mittel f ü r ihre Arbeit müssen der Heilsarmee durch die freiwilligen Beiträge ihrer Glieder und
durch Spenden ihrer Freunde zufliessen. F ü r die Übernachtung in den Obdachlosenheimen sollen, dem Prinzip nach, kleinere Beiträge entrichtet werden.
Die EVANG. LUTHERISCHE KIRCHE in Chile nimmt, wie bereits erwähnt,
in der Reihe der anderen protestantischen Kirchen eine Sonderstellung ein. Ihre
ersten Gemeinden wurden um 1860 gegründet. Es waren Gemeinden, die sich
ausschliesslich aus Menschen deutscher Sprache zusammensetzten und so ist es,
mit ganz geringen Abweichungen, bis heute geblieben. Die Lutherische Kirche in
Chile kann gewiss mit Recht als die starke Hüterin und als die Heimat des
Deutschtums im tiefsten Süden von Südamerika bezeichnet werden. Die sozialen
Bemühungen der Lutheraner in Chile mussten von daher zwangsläufig in der
Vergangenheit in eine andere Richtung weisen. Es sind nicht zuletzt in Chile
die evang. kirchlichen Gemeinden gewesen, die die Gründung und Bildung deutscher Schulen verursacht oder gefördert haben; wenn sie auch nie selbst als Träger solcher Schulen in Erscheinung getreten sind. Ähnlich verhält es sich mit dem
Altersheim in Osorno, oder dem Waisenheim in Traiguén, welches jetzt allerdings
in staatliche Hände übergegangen ist.
Eine soziale Hilfsaktion eigener Art stellte in den Jahren nach dem zweiten
Weltkrieg die Eingliederung von etwa 500 deutschen lutherischen Einwanderern
dar, die vorwiegend von dAi lutherischen Gemeinden in den Provinzen Osorno
und Llanquihue aufgenommen worden sind.
Zur Zeit vollzieht sich eine zwar langsame, aber doch stetige soziale Neube106
sinnung. Die Uberzeugung wächst, dass auch die lutherische Kirche ihren Beitrag
und ihren Anteil, — bis an die Grenze des Möglichen — der sozialen Frage dji
Chile zuordnen muss. Diese neue Zuwendung bedeutet (keineswegs eine Veränder u n g oder ein Verlassen der bisherigen Linien. Die evang. Luth. Kirche in Chlie,
soll gewiss auch weiterhin unsere deutsche Koloniekirche bleiben. Aber sie soll
und darf nicht nur in der Etappe sein, sondern sie soll und muss, wie die anderen, an die Front, an die soziale Front, an der es brennt. Dass sie auf dem besten Wege dorthin ist, wird deutlich durch die kirchlichen Bemühungen um die
Gründung der Gewerbeschule in Frutillar, der Landwirtschaftsschule bei Victoria. der beachtlichen finanziellen Unterstützung, die die Ayuda Cristiana Evangélica f ü r die Bildung ihrer Sozialzentren im Lande erhielt und der Dinge mehr.
Alle diese kirchlichen Bestrebungen evangelischer Sozialarbeit in Chile erfahren die mögliche und vielschichtige Unterstützung durch die AYUDA CRISTIANA EVANGELICA. Diese Einrichtung, die vorwiegend vom Weltrat der Kirchen und vom lutherischen Weltbund unterhalten und deren Arbeit im Lande
Chile vor allem durch das Abkommen der Vereinigten Staaten von Nordamerika
und der chilenischen Republik vom 5. April 1955 ermöglicht wird, ist die helfende
und schützende Dachorganisation für alle Äusserungen evangelischer Liebestätigkeit in Chile, ohne deren Eigenständigkeit und Eágenartigkeit zu berühren.
Durch das erwähnte Abkommen wird die Arbeit dieser Organisation als "Agencia
de trabajo social" von der chilenischen Regierung anerkannt und erfährt die gebührende Bewertung. Die evang. Kirchen in Chile entsenden ihre Vertreter in den
Consultativrat dieser Einrichtung und sind hierdurch an deren Arbeit und Verantwortung unmittelbar beteiligt. Um gegenüber den chilenischen Behörden einheitlich auftreten zu können und um den staatl. Dienststellen die Möglichkeit zu geben nur mit einer Institution aller prot, Richtungen vollgültig zu verhandeln,
wurde die "Junta Asesora Cristiana" gegründet, der die meisten prot. Kirchen in
Chile angehören.
Ayuda Cristiana Evangélica gilt als Vertretung des Weltkirchenrates und des
luth. Weltbundes in Chile. Die Arbeit wird sachlich aufgegliedert, von 5 verschiedenen Abteilungen (Departamentos), geleistet. Über das Departamento de Alimentación werden sämtliche Lebensmittel und Bekleidungsspenden, die zumeist
aus den USA kommen, an die verschiedenen Hilfskomitees der einzelnen Kirchen
im Lande verteilt. Zur Zeit werden in Chile 130.000 Personen, 14-tägig, über die
Komitees mit Lebensmitteln betreut.
Das "Departamento de Reconstrucción", ist erst nach- dem grossen Erdbeben
vom Mai 1960 eingerichtet worden. Die Aufgabe dieses Departamentos besteht in
der baulichen Mitwirkung bei Schaffung der Sozialzentren, sowie in der bau-fachlichen Beratung, Betreuung und Hilfe bei der Wiederherstellung einer ganzen
Reihe evangelischer Kirchengebäude und Lakale, die durch das erwähnte Erdbeben zerstört, oder in Mitleidenschaft gezogen worden sind.
Das Departamento "Servido Social" (sozialer Dienst) dient der sozial-pädagogisch-fachlichen Unterstützung bei der Einrichtung der evangelischen Sozialzentren in den verschiedenen Städten Chiles. Ausserdem steht dieses Departamento auch f ü r soziale Beratungen allgemeiner Art, den anderen Abteilungen,
bezw. den einzelnen prot. Kirchen zur Verfügung.
107
Ausser dem „Departamento de Administración" ist in die Arbeit der Ayuda
Cristiana Evangélica íioch das "Departamento de Inmigración"
eingegliedert.
Dieses Departamento ist die Einwanderungsabteilung des Weltrates der Kirchen
in Chile. Ausser der Regelung von Einwanderungsfragen, wird von diesem Departamento eine nicht unerhebliche Betreuungs- und Eingliederungsarbeit an den
rund 200C Einwanderern geleistet, die durch „World Council oi Churches" nach
Chile gekommen sind. Zumeist kommen diese Einwanderer aus den südosteuropäischen Ländern, bei einem anderen Teil handelt es sich u m russische Flüchtlinge aus China, die über Hongkong nach Chile kamen.
Im Rahmen der Arbeit der Ayuda Cristiana Evangélica in Chile ist zuletzt
noch auf die Mitwirkung beim sogenannten CALAMA-PROJEKT hinzuweisen.
Hierbei handelt es sich u m die geplante Bewässerung eines Teiles der Atacamawüste im Norden .von Chile, die zu einem gutem Teil mit Mitteln des Weltrates
der Kirchen und des Lutherischen Weltbundes durchgeführt werden soll. In Calama ist weiterhin ein Sozialzentrum in der Planung und Durchführung begriffen, dessen Träger die Heilsarmee wird, dessen Erstellung aber weitgehend Ayuda Cristiana Evangélica ermöglicht.
Wenn durch die Aufzeigung all' der verschiedenen Bemühungen deutlich wird,
dass die evangelischen Kirchen und Gemeinden sich gerufen wissen, der Not in
all' ihrer Gestalt zu begegnen, so muss hiermit die Feststellung verbunden werden, dass diese Anstrengungen, bis an die Grenze des Möglichen, eine Vergrösserun-g zu erfahren haben. Die Not und die soziale Unsicherheit in Chile ist gross
und es ist noch ein weiter und ein steiler Weg, der gar noch geschaffen werden
muss, bis zur Erreichung einigermassen befriedigender Verhältnisse. Aber gibt es
eine vornehmere und würdigere Aufgabe, als an dem Bau dieses Weges mitzuhelf e n ? ? — Wir haben gerade in Chile alle Möglichkeiten und alle Freiheiten dazu.
Die soziale Arbeit ist nicht ein Reservat des Staates oder der katholischen Kirche.
Die evangelische Liebestätigkeit ist so bitter nötig, wie der Regen f ü r die
Mittelzone. Man äst auf uns und auf unsere Mitsarge angewiesen* man wartet auf
unsere Mithilfe. Die streunenden, verwahrlosten und bettelnden Kinder, die hungernden und frierenden und unversorgten Alten, die Krüppel, die ihre Gebrechen
an den Ecken feilbieten, die Tauben und Blinden, die Kranken und die Trunkenbolde. Es gibt in Chile kein einziges Heim für Epileptiker, es gibt keine Trinkerfürsorge, (keine Blindenhilfe, keine umfassende Tbc-Fürsorge, es gibt keine Arbeitslosenunterstützung, es gibt keinen staatlichen Schutz vor dem Verhungern.
Der Strafvollzug ist zum Teil unwürdig, die Erziehungsnot ist riesengross. Sie ist
wie eine Geissei, die nicht nur auf den Kindern und auf der Jugend liegt, sondern
auf einem grossem Teil der erwachsenen Bevölkerung.
Ein grosses und weites Feld auch f ü r die evangelische Sozialarbeit der Zukunft. Das. Motiv: um Christi Liebe willen; der Weg: durch seinen Geist und mit
seiner Kraft; das Ziel: die Verherrlichung seines Reiches.
108
HANS HOLLEDEREK — Osorno
Grund und Wesen christlicher Diakonie
Es ist eine in der Kirche Jesu Christi zwar oft verdunkelte, aber im Grunde
nia vergessene feste Erkenntnis, dass Kirche ohne helfende Diakonie keine rechte Kirche ist. Wie unumgänglich diese Diakonie ist, hat sich gerade in den T a ger. nach dem grossen Erdbeben vom 21. und 22. Mai 196C erwiesen. Was wäre
geworden, wenn wir in dieser Zeit nicht die helfende Diakonie der christlichen
Welt hätten spüren dürfen, deren Mittelstelle in Santiago dann die Ayuda Cristiana Evangelica geworden ist? Eine Besinnung über unser Thema „Grund und
Wesen christlicher Diakonie" kann und darf daran nicht vorübergehen. Sie möge
selber als ein Wort des Dankes genommen werden, den wir hier in Chile den
Brüdern und Schwestern in allen christlichen Kirchen der Welt schulden! Sie
möge aber darüber hinaus ausserdem dazu helfen, dass unsere Kirche immer weiter schreite auf dem Wege der Kirohwerdung. Mit dem im Jahr 1959 durchgeführten Namenswechsel allein ist es ja nicht getan, so legitim und notwendig
er war. Unsere Evangelisch-Lutherische Kirche in Chile wird nicht nur ihren
einzig legitimen Beitrag zur weiteren Entwicklung des Landes leisten, wenn sie
immer mehr wird, was Kirche zu sein hat: Schar derer, die Jünger Jesu Christi
ind, und ihre Glieder werden ihrerseits ihren Beitrag dann recht leisten, wenn
ie zuerst und in allem nichts anderes sind und sein wollen als Jünger Jesu
/hristi.
Ich darf versichern, dass diese Besinnung nicht am grünen Tisch entstanden
Li. Sie ist eigentlich nichts weiter, als eine nachträgliche Besinnung über einen
kurzen. Abschnitt meines Dienstes als P f a r r e r der Kirche Jesu Christi in den
Jauren 1947 und 194S, da ioh im Landesverband der Inneren Mission der Evang.
Lvfth. Kirche in Bayern tätig war. Sie will und soll so nichts anderes sein als die
voi* Dienst unter Gottes Wort ständig geforderte Besinnung, unter jenem Wort,
von dem. w i r als Diener des Wortes Gottes besonders — wie aber ebenso auch
alle anderen Christenmenschen — die einzige Ausrichtung unseres Lebens und
Handelns empfangen.
Vir haben uns mit unserem Thema auf ein weites Feld begeben. Was verbinde\ sich, allein schon mit dem Begriff „Diakonie"! E s steht, damit vor unseren
Augei\ ein Werk der Kirche Jesu Christi in dieser Welt, das eine reiche Geschichte hat, aber ebenso gleichzeitig vom Versagen und vom Ungehorsam von uns
Christen berichtet. Noch m e h r freilich berichtet diese Geschichte der christlichen
Diakonfc von der Gnade Gottes, der von Anfang der Kirchengeschichte an bis
S
109
heute seiner Kirche Männer und Frauen geschenkt hat, die das Feuer seiner Liebe durch die Kraft des Heiligen Geistes immer neu entzündet haben. In dieser
Geschichte haben ihren Platz die Apostel ebenso wie die ersten sieben Diakone
mit dem Erzmärtyrer Stephanus. eine Diakonisse Bhöbe wie die im Neuen. Testament oft genannten Witwen oder ein Johannes, der nicht müde wurde, durch
seine Briefe die Liebe Christi den Gemeinden einzuschärfen. In ihr leuchten
Männer wie St. Laurentius, Benedikt von Nursia , Franziscus von Assissi, die
Ritterorden des Mittelalters, die Mönchsorden, mit ihren Hospitälern ebenso wie
Vinzenz von Paulo oder der Vater der Waldenser, Petrus Waldus, Martin Luther,
Johannes Calvin, Elizabeth Fry, Theodor Fliedner, Wilhelm Löhe, der grosse
Johann Hinrich Wichern. Friedrich von Bodelschwingh, Vater und Sohn, oder
William Booth und seine Helfer der Heilsarmee. Zu ihnen gehören aber auch die
Heere der Liebe und Diakonie, die aus den Gemeinden der Kirche Jesu Christi
hervorgegangen sind, um dem Rufe ihres Herrn Folge zu leisten.
Wir sagen das nicht — und haben es nicht zu sagen! — aus falschem Stolz,
um unsere odei der Kirche Taten zu preisen. Wo dies über uns kommen sollte,
denke man lediglich an das J a h r 1848! Es wird sich dann zeigen, dass die Haltung
eines Christenmenschen der demütige Dank gegenüber Gott ist, der seine Kirche
— und die Welt — trotz unserer Sünde und unseres Versagens weiterführt.
Das Jahr 184S ist das Geburtsjahr vieler Bewegungen. In ihm gründete der
erste Kirchentag der Evangelischen Kirche in (Deutschland au Wittenberg den
Zentralausschuss der Inneren Mission in Deutschland. In ihm rief aber auch ein
Karl Marx sein „Kommunistisches Manifest" ihinaus, den Startschuss für eine
Bewegung, die ganz und gar nicht zum Stillstand gekommen ist. E s ist sehr die
Frage, ob die Fackel dieses Manifests in einer derartigen Weise den Marxismus
hätte entzünden können, wenn die Christenheit in ihrer Gesamtheit mehr den
Rui der Männer ihrer Diakonie und Inneren Mission gehört hätte, anstatt ihr«
„ Hauptauf gäbe in der Konservierung unzeitgemässer Ordnungen
in Anbetracht
der grossen industriellen Revolution zu sehen. Es ist das auch noch die Frage
an uns Christen von heute: Tun wir — wir Christen von heute — das Nötige, urn
einen Klassenkampf von vornherein gar nicht aufkommen zu lassen? Hören wir
— wir Christen von heute — den Ruf eines Johann Hinrich Wichern vom schon
erwähnten 1. Kirchentag zu Wittenberg, den er von der Kanzel über dem Grabe
Martin Luthers den dort versammelten Kirchenführern zugerufen hat:
„Meine Freunde, es tut eines not, dass die evangelische Kirche in iirer
Gesamtheit anerkenne: Die Arbeit der Inneren Mission ist mein, dass ein
grosses Siegel sie auf die Summe dieser Arbeit setze: D i e L i e b e g e h ö r t
m i r w i e d e r G l a u b e . Die rettende Liebe muss ihr das grosse Werkzeug
werden, womit sie die Tatsache ihres Glaubens erweise. Die Liebe mijss in
der Kirche wie die helle Gottesfackel flammen, die kundmacht, dass Cljristus
eine Gestalt in seinem Volke gewonnen hat. Wie der ganze Christus im lebendigen Gotteswort sich offenbart, so muss er auch in den Gottestaten sich
predigen und die höchste, reinste, kirchlichste Tat ist die rettende Liebe.
Wird in diesem Sinne das Wort der Inneren Mission aufgenommen, sb bricht
in unserer Kirche jener Tag ihrer neuen Zukunft an."
Das Jahr 184g ebenso wie die soziale Situation unserer Zeit zeigen genauso
110
wie die politische, dass wir uns damit auf einem höchst aktuellen Boden befinden. Der Herr der Kirche, Jesus Christus, befasst uns Christen und seine Kirche
nie mit Allotria, sondern jedesmal mit den aktuellen Fragen unseres Lebens. Wir
sagen freilich nicht zuviel, wenn wir feststellen, dass das alles noch lange nicht
allgemeines Wissen und allgemeine Erkenntnis derer ist, die sich Christen nennen und beleidigt wären, wenn man ihnen diesen Namen abstritte. Müsse es nicht
sonst ganz anders aussehen in unserer Umwelt? Müsste nicht etwa ein Albert
Schweitzer viel mehr Nachahmer finden — und das nicht nur in Zentralafrika?
Sind nicht im Gegenteil viele der Meinung, dass das zwar ein achtungsgebietender Idealismus sei, was da Schweitzer tue, aber im Grunde vergeudete K r a f t ?
Oder dürfte es überhaupt Schwierigkeiten in sogenannten guten christlichen Gemeinden geben, wenn, die Kirche und ihre Diakonie sich gerade der Gefallenen
annimmt — ach, wie wenig tun wir hier bei uns! — und dafür natürlich auch
Kollekten verlangt? Aber da erfährt man — wie etwa unsere bayerische Innere
Mission im Falle eines Entbindungsheimes: „Für sc etwas geben wir keine Kollekten!" Man sagt das aber wahrlich nicht nur in Bayern. Man frage einmal die
Sammler und die Sammlerinnen der Heilsarmee hier bei uns, was sie für Antworten bekommen, wenn sie eine Gabe für ihre Arbeit erbitten! Wo ist hier überhaupt die Sozialarbeit unserer Kirche — nicht nur an ihren eigenen Gliedern?
Oder wo ist unsere Besinnung und Arbeit ob der grossen sozialen Fragen unseres
Landes: des Wohnungsproblems, das sich in den „Casas Callampas" uns bietet,
des sozialen Ausgleichs und sauberen Betriebsklimas., des gerechten Lohnes, der
guter Erziehung aller? Hier wird doch unser grosses Versagen gegenüber den
aktuellen Fragen nur zu sichtbar. Vor sie aber hat uns Gott selber gestellt, wenn
anders wir recht tun mit unserem Glaubensbekenntnis: „Ich glaube an Gott den
Vater, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels ¡und der Erden".
Doch warum gehört nun zu Kirche und Christ die Liebe wie der Glaube?
Warum treibt die Kirch« ihre Diakonie?
Sicher gibt es viele Gründe, um eine soziale Arbeit anzufangen. Wer h ä t t e
ein Recht die Idealisten des Humanismus zu kritisieren? Welchem Staat muss
nicht daran liegen, ein ausgeglichenes soziales Klima mit sauberen Verhältnissen
in den Betrieben innerhalb seiner Grenzen zu bekommen?
Doch das sind nicht unsere Gründe. Es gibt f ü r den Christen nur e i n e Antwort auf die Frage nach dem Ursprung christlicher Diakonie. Um dieser Antwort
willen hatte damals Johann Hinrich Wichern es formuliert:
„Eines tut not, dass die evangelische Kirche in ihrer Gesamtheit anerkenne: Die Liebe gehört mir wie der Glaube."
Die Frage nach dem Ursprung christlicher Diakonie erfährt daher ihre Antwort aus der rechten Beantwortung der Frage:
Wer ist das denn: die Kirche?
Wer ist das denn: ein Christ?
Es wird sich dabei herausstellen, dass Diakonie der Kirche und eines Christen nicht persönliche Liebhaberei einiger weniger ist oder sein darf. Kirche ist
111
nun einfach mehr als der Verein derer, die eben gerade diesen Jesus Christus
verehren, wie andere Buddha oder Lenin usw. Es handelt sich dabei nicht um
eine der vielen möglichen oder auch unmöglichen Arten der religiösen Betätigung. Wir haben vom Neuen Testament eine andere Antwort und wir wissen,
dass es sich dabei um eine Wirklichkeit handelt, an der wir nicht mehr vorbeikommen. Darum ist es eine klassische Formulierung, wenn Luther in den Schmalkaldischen Artikeln sagt — und wir sollten sie in allem recht hören:
„Es weiss gottlob ein Kind von 1 Jahren, was die Kirche sei, nämlich die
heiligen Gläubigen und die Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören".
Das und nichts anderes ist die Kirche. Der und kein anderer ist daher ein
Christ, der bekennt: „Jesus Christus ist mein Herr." Sollte aber nun die Kirche,
sollte ein Christ am eindeutigen Wort und Auftrag dieses Herrn vorübergehen
können?
So abei sprich) dieser Herr:
„Geht aber und predigt und sprecht: Das Himmelreich — die Herrschaft
Gottes — ist herbeigekommen. Macht Kranke g e s u n d . . . " Matth. 10, 7 f.
„Geht hin und machet zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten
alles, was ich euch befohlen h a b e . . . " Matth. 2S, IS f.
„Was ihr getan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das
habt ihr MIR getan. Was ihr nicht getan habt einem unter diesen Geringsten,
das habt ihr MIR auch nicht getan." Matth. 25, 40, 45.
Das Gleichnis vom harmherzigen Samariter (Lukas 10) endet mit dem klarer, Wort: „So gehe hin ¡und tue desgleichen!" und über sich selbst sagt Jesus und
lässt dabei keinen im Unklaren, dass das ebenso auch der Weg des Christen sei:
„Des Menschen Sohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass
er diene — griech.: diakonein — und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele." Schliesslich sagte der Auferstandene doch wohl deswegen zu seinen Jüngern
nach Apg. 1, 9:
ihr werdet meine Zeugen sein..."
Es ist deshalb nur folgerichtig, wenn Paulus im 1. Korintherbrief das hohe
Lied auf die Liebe singt — aber weder auf die prostituierte Liebe der Strasse
oder der Schlager noch auf die rührselige solcher, die nicht Nein sagen können,
noch auf den edlen Eros, sondern auf die Caritas — oder wenn er aus dem Gefängnis nach Philippi an die dortige Gemeinde schreibt:
,'Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war:
welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war,
nahm er's nicht f ü r einen R a u b Gott gleich zu sein,
sondern entäusserte sich selbst und nahm K n e c- h t s g e s t a 11 an,
ward gleich wie ein anderer Mensch
und an Gebärden als ein Mensch erfunden.
Er e r n i e d r i g t e sich selbst
und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuze." Phil. 2, 5 ff.
112
Darum handelt es sich. Wir Christen — seine Kirche — stehen im Auftrage
Jesu Christi. Wir haben sein Beispiel. Und mögen ein Nietzsche -und seine Nachbeter, die doch nichts anderes vollbracht haben als Europa durcheinanderzubringen, das als niedere Sklavenmoral bezeichnen.
Das Heil und die Gesundung; geht nur von dieser Ethik aus und die Welt war
da in Ordnung, wo das Beispiel Jesu die Moral der Harpen und Führer der Völker war.
Doch nicht nur das. Es war vor allem Paulus, der immer wieder darauf hingewiesen hat, was ihn trieb, Botschafter Jesu Christi zu sein, ja was das bewegende Moment im Christenleben überhaupt ist. Was gründete denn die Kirche?
War es nicht die Macht und die Liebe Christi selbst? Wären es nur die erlauchten Gedanken des „Philosophen von Nazareth", die iuns zu ihm und zur Kirche
führen, dann genügte ein wenig Idealismus. Er würde freilich bald erlahmen und
schwach werden über dem, was an Sünde und Armut und auch an Dreck über
einen bei und in der sozialen Arbeit hereinstürmen kann. Aber Kirche ist ja etwas
ganz anderes. Darum ist von der Kirche im 3. Glaubensartikel die Rede, im gleichen Artikel, in dem die Kirche die Herrschaft des Heiligen Geistes und die Vergebung der Sünden bekennt, um zu dokumentieren, dass sie deswegen die Gemeinde der Heiligen ist, weil sie, und jeder, der zu Christus kommt, von der Vergebung der Sünden leben darf, sie, von der es im 1. iPetrusbrief geradezu als Begründung des Auftrages eines Christenmenschen heisst:
„ . . . d i e ihr vormals .nicht ein Volk' wart, nun aber .Gottes Volk' seid,
und vormals nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid." 1. Petr. 2.
Martin Luther hat deswegen in seiner Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen" seine berühmten Sätze formuliert:
„Ein Christenmensch ist ein.freier Herr aller Dinge und niemand Untertan.
Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jederman Untertan "
Ich fasse zusammen:
Die Christenheit — ein Christenmensch — braucht nicht lange zu überlegen,
ob sie, ob er iDiakonie treiben soll oder nicht, ob die soziale Arbeit ihr, ob sie ihm
zugehört oder nicht. Es ist wie bei einem Baum. Wenn er lebt, treibt er Blätter,
Blüten, Früchte. Hat er das nicht, ist er tot. Fehlt der Kirche die' Diakonie, die soziale Arbeit und die Liebe, ist sie nicht mehr Kirche und als Kirche tot, selbst
wenn noch so viel Betrieb in ihr wäre. Unser Herr hat seine Kirche deswegen in
dieser Welt gegründet, dass sie sein Zeugnis weitergebe als die Gemeinde
derer, die genau das an sich erfahren haben, was Christus schenkt, nämlich Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit. Dazu ist die Kirche, dazu sind die Christen da, dass sie in dieser Welt als Gesandte Christi verkündigen, der in seiner
unergründlichen Liebe gekommen ist, auf dass wir verlorenen und verdammten
Menschen durch ihn Gerechtigkeit, Freiheit, Friede und Heimat fänden. So rich113
tet die Kirche hier in der Nachfolge Jesu durch ihren missionarischen Dienst,
überall wo sie ist, das Zeichen der anderen Welt auf, die kommt und die doch
in IHM — Jesus Christus — schon da ist, als die „Vorthut des Reiches Gottes"
(Karl Barth), die verkündigen soll die Wohltaten des, der uns berufen hat aus
der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht." (1. Petr. 2, 9).
In welcher Art aber vollzieht sich hun dieser Dienst?
Auch hier gilt es von der Überlegung auszugehen, wer diesen Dienst tut, wer
also die Kirche ist.
Kirche — so möchten wir formulieren — ist die Gemeinde d e r e r , die von Jesus Christus zum rechten Gottesdienst geführt worden sind.
Man verstehe mich nicht falsch. Es geht hier nicht zuerst um die liturgischen
Formen. Ich nehme sie in keiner Weise als etwas Nebensächliches und halte es
nicht f ü r legitime Redeweise in der Kirche, wenn m a n sagt, es sei völlig nebensächlich, welcher Art der Verlauf des Gottesdienst der Gemeinde sei. Schliesslich
ist dieser Gottesdienst die Mitte des Lebens und nicht nur der feierliche Rahmen.
Wir haben darum auch die Gestaltung der Liturgie w a h r h a f t ernst zu nehmen.
Es waren darum die Stätten der Diakonie immer Orte, die das liturgische Leben
sehr befruchtet haben.
Dooh wenn wir vom Gottesdienst reden, meinen wir nicht nur die kultische
Handlung. Wer vom Neuen Testament herkommt, hat dieses Wort in seiner u m fassenden Bedeutung im Auge zu behalten. Andernfalls gilt über ihn und sein
Reden der Satz Jesu, den er aus den Propheten aufgegriffen hat:
„Gehorsam ist besser denn Opfer".
Das Neue Testament hat gerade darin die prophetische Predigt bewusst a u f genommen, dass es vom falschen zum rechten Gottesdienst f ü h r e n wollte. Wie könnte das auch anders sein, da es doch nicht vom mystisch erahnten, nicht vom philosophisch erdachten Gott redet, sondern von dem Gott, der in das Leben der P r o pheten getreten war, so dass sie lediglich antworten konnten: „Rede, Herr, dein
Knecht hört" (1. Sam. 3, 10), von dem Gott, der in Jesus Christus sich geoffenbart hat, sodass Johannes bekennt: „Das Wort ward Fleisch und wohnte unter
uns und wir sahen seine Herrlichkeit." (Joh. 1, 14). D a r u m überschreibt Paulus
in seinem grundlegenden Römerbrief den Abschnitt über das christliche Leben:
„Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr
eure Leiber begebet zum Opfer, das da lebendig, heilig, und Gott wohlgefällig
sei. Das sei euer v e r n ü n f t i g e r G o t t e s d i e n s t." (Rom. 12, 1).
In dreifacher Weise umschreibt das Neue Testament
Gottesdienst": Er ist leiturgia, diakonia, martyria.
diesen „vernünftigen
Für uns klingen damit feste Begriffe an, wie sie sich ja im Laufe der Sprachentwicklung zu den Begriffen Liturgie, Diakonie und Zeugnis des Märtyrers entwickelt haben. Im Neuen Testament bedeuten sie aber das noch nicht, sondern
sind sie drei Seiten der gleichen Sache, des gleichen Dienstes, des Gottesdienstes
der Gemeinde Jesu Christi.
114
Es hat darum auch f ü r unsere soziale Arbeit zu gelten, dass sie im engen
Zusammenhang mit dem gottesdienstlichen Leben der Kirche steht. Was wir hier
in der Sozialarbeit der Kirche tun, ist nichts anderes, als dass wir ausserhalb des
Kirchenraumes das weiterführen, was in der Stunde des Gottesdienstes Gottes
Wort uns als Auftrag Gottes gegeben hat, wenn anders wir eine Gemeinde sein
wollen, die am Sonntag, dem ersten Tage der Woche zusammenkommt, um der
Auferstehung Jesu sich zu getrösten und seiner Gegenwart zu freuen. Was wir
also tun, ist nichts anderes als der eine Gottesdienst, zu dem wir als Gemeinde
Jesu Christi gerufen sind, als der Gottesdienst, der vom Neuen Testament Leiturgia, Diakonia und Martyria genannt wird, und so seine drei Seiten hat. Keine
darf von der anderen getrennt werden. Diakonie ist nicht mehr rechte Diakonie,
wenn sie nicht in der Liturgie zu Hause ist und die Martyria verloren hat oder
nicht üben will und umgekehrt gilt genau dasselbe.
Lasst uns recht überlegen, dass das eine ganze Reihe f ü r unseren Dienst bedeutet!
So bedeutet es, dass wir nicht nur um des Mitleides willen Almosen austeilen. Almosen haben sicher auch ihr Recht. Es gibt f ü r sie eine Reihe von G r ü n den. Manche möchten mit ihnen z. B. ihr soziales Gewissen abreagieren und beruhigen. Nur — Christen können das nicht. In ihrem Dienst geht es überhaupt
nicht um Almosen. Wer in der Schule der alten Propheten gesessen hat und noch
sitzt, wer Jünger Jesu Christi ist — zusammen mit den Vätern der christlichen
Diakonie — weiss, dass unser Gottesdienst nur dann recht getan ist, wenn uns
die soziale Gerechtigkeit ein heiliges Anliegen ist.
Es handelt sich darum in unserem Dienst auch nicht nur um karitative Betreuung. Die Zeit erfordert mehr. Oder wollen wir die anderen, die keine Christen
sind und auch keine sein wollen, die Anwälte der Gerechtigkeit sein lassen, da
uns unser Herr das doch wahrhaftig ans Herz gelegt hat? Durch das Gleichnis
vom reichen Mann und dem armen Lazarus ist das doch sehr deutlich gezeichnet
(Lukas 16 19—31).
Der sowjetrussische Film „Don Quichote" stellt besonders deutlich die
Szene heraus, in der Don Quichote zu einem Bauern kommt, der gerade einen
Jungen, den er wie einen Sklaven hält, erbarmungslos verprügelt. Don Quichote befreit den Jungen, ermahnt den Bauern und reitet davon. Den Jungen aber lässt e r in der Gewalt des Bauern, obwohl dieser ihn inständig bittet,
ihn doch mitzunehmen. Nach Jahren kommt er wieder am Bauernhof vorbei.
Als der Junge Don Quichote wieder erkennt, flucht er ihm 'und bewirft ihm
mit Steinen; denn der Bauer hatte den Jungen nach Quichotes Fortritt fürchterlicher als je behandelt. Don Quichote hatte zwar einmal geholfen, aber er
hatte dem Jungen nicht aus seinen Verhältnissen geholfen.
Soziale Gerechtigkeit, Änderung der schlechten sozialen und wirtschaftlichen
Verhältnisse sind heute Schlagworte, die uns von einer ganz bestimmten Seite'
entgegenkommen. Sie könnten nicht zünden, wenn der Zündstoff nicht vorhanden wäre, wenn „Christen" nicht immer neuen Zündstoff schafften. Wir werden
gewiss mit unserer Kraft nicht viel ändern. Aber das wache Gewissen einer
115
Gemeinschaft, das wache soziale Gewissen eines Staates sollten die Christen im
Dienste ihres Herren sein, in ihrer Diakonie, die mit Jesus nicht nur Almosen,
sondern echte Hilfe geben soll. Christus hat uns wahrhaftig nicht zu Konservatoren alter zusammenbrechender Gefüge bestellt, an deren Zusammenbruch wir
noch selbst schuldig sind.
Christliche Diakonie ist Gottesdienst, Wo man das weiss, wird sich manches
Problem von selbst lösen, so etwa wenn auch der Staat eine rege Sozialarbeit
unterhält oder wenn uns diese Arbeit schwer und sauer werden will. Durch das
Wissen um unseren Gottesdienst allein werden wir Arbeiter Jesu Christi davor
bewahrt, falsche Wege zu gehen, wie die Kirche sie oft genug im Laufe der Geschichte gegangen ist, jedesmal wenn sie nicht mehr um die Dreiheit des wahren,
„vernünftigen Gottesdienstes" wusste. Freilich werden wir dabei wenig Lorbeeren
ernten können. Denn in diesem Gottesdienst wird man zu vielem Nein sagen müssen, was andere f ü r möglich halten und dann eben verlangen oder selber tun. Vor
allem arbeitet man im Gottesdienst allein ad majorem gloriam Dei Omnipotentis
et ad salutem fratrum und auf keinen Fall zum höheren Ruhm irgend einer irdischen Grösse, auch nicht des Vaterlandes. Wir möchten allerdings sofort hinzufügen es gibt keinen besseren Dienst fürs Vaterland als diesen zur Ehre Gottes
und zum Heile der Brüder. Jeder Staat und jede Gemeinschaft werden gut, wirklich sehr gut beraten sein, wenn sie diese Diakonia, Leiturgia, Martyria ungehindert geschehen lassen und sogar fördern, selbst wenn ihnen dabei unangenehme
Dinge gesagt werden, wie es einst Friedrich von Bodelschwingh Vater im preussischen Landtag und Friedrich von Bodelschwingh-Sohn gegenüber den E u t h a nasieärzten des Dritten Reiches getan haben. Die Geschichte hat noch immer bewiesen, dass der Staat am besten gefahren ist, der innerhalb seiner Grenzen viele
Menschen hatte, die ad majorem gloriam Dei et ad salutem f r a t r u m gearbeitet
haben. Es kann und wird wohl auch sein, dass dann trotzdem über unsere Arbeit,
wie etwa auch über die Arbeit Albert Schweitzers gesagt wird: „Man arbeite ja
doch nur im Solde irgend welcher Mächte". Warum soll sich an uns ausgerechnet
nicht erfüllen, was im Neuen Testament Christus über seine Jünger sagt? Aber
wir können ruhig und getrost sein: Wo unser Dienst, unsere Diakonie ein Stück
unseres Gottesdienster. jener Dreiheit von Leiturgia, Diakonie, Martyria ist, da
haben wir Gott auf unserer Seite, IHN, der das letzte Wort auf alle Fälle sprechen wird. Wir sind kein verlorener Haufe, sondern die Vorhut einer Macht, die
am Ende die einzige Macht sein wird.
Wir müssen freilich auch darum wissen — und wem wtürde das nicht gerade
im Gottesdienst deutlich: Kirche ist die Gemeinschaft derer, die durch Jesus
Christus sich selbst, d. h. den Menschen in seiner Sündhaftigkeit kennen gelernt
haben und darum sich keinen Illusionen mehr hingeben können,
Kurz und bündig gesagt, heisst das: Wir wissen um den Menschen; denn im
Lichte Christi sind wir vor Gott gestellt worden und können wir nicht mehr sagen : „Ich d a n k e . . . dass ich nicht bin wie andere Leute". Es bleibt uns nur noch
die Zöllnerbitte: „Gott, sei mir Sünder gnädig!" Wir sitzen ja nicht auf einem
moralischen Podest, von dem herab wir über die Welt und ihre schlechten Men116
sehen klagen dürften. Es wäre einer der schlimmsten Sündenfälle, in die wir geraten können — und wie oft gerät man in solche Versuchung!
In unserem Dienst haben wir ja immer mit Menschen zu tun. Der Mensch
aber hat ein tausendfältiges Gesicht. Wem begegnet m a n dabei nicht! Da sind
sie: die Verwahrlosten, die Betrüger, Säufer, Dirnen usw. usw. Auch sie fehlen
nicht, von denen m a n sagen möchte: „Hier ist Hopfen und Malz verloren." Vor
keiner Dämonie werden wir verschont bleiben. Auch sie werden uns begegnen
von denen m a n sagt, dass sie keinen Schuss Pulver wert seien, oder auch die die
nach weit verbreitetem — und leider oft sehr offiziellem — Urteil, an dem trotz
Hy-pokrates sogar Ärzte sich beteiligen, zum „unwerten Leben" gehören und deshalb vernichtet werden sollten, wie man sagt. Aber es genügt auch schon der Alltag in einem Heim. Welcher Leiter ist um seinen Dienst zu beneiden?
Was sollen wir aber t u n ? Sollen wir einteilen in wertvolle und nicht w e r t volle Menschen, solche, denen geholfen werden kann und solchen, die man verkommen lassen darf, weil sie nichts taugen? An welch furchtbares Problem r ü h ren wir damit! Die Lösungsversuche des 20. Jahrhundert — und nicht nur im
alten Europa — sind nicht gerade ein Ruhmesblatt f ü r unsere christliche Welt
Mit tiefer Beschämung n u r kann ich feststellen, dass ausgerechnet in meinem
Vaterland man am meisten in Euthanasie und Rassenkriminierung und Rassen—
hass gemacht hat und wir nicht lauter geschrieen haben, als die Gaskammern sich
öffneten und die Krematorien anfingen zu rauchen.
Angesichts einer solchen Situation werden wir Christen unseren Dienst nur
dann recht tun können, wenn wir illusionslos über uns selbst Bescheid wissen.
Wer nicht täglich an ihn herantritt mit dem Gebet auf den Lippen: „Herr, ö f f n e
meine Augen!", um die Notwendigkeit des Gebetes zu erkennen: „Gott, sei mir
Sünder gnädig!", wird nur zu bald die Art des Samariters aus Lukas 10 verlieren
und Kirche und Diakonie mit einer Besserungsanstalt verwechseln. Er wird bald
vergessen, warum Christus am Kreuze gestorben ist und uns im heiligen Abendmahl das Mahl f ü r die Sünder gegeben hat. Diakonie ist nur dann wirklich Diakonie, wenn sie den Weg Gottes nachvollzieht und in die gleiche Solidarität mit den
Sündern hinabsteigt, wie unser Herr selber, wenn sie rweiss um die Anfechtungen, Nöte, Niederlagen und Sündn der Menschen. Wie soll ich denn rechte Seelsorge üben können, wenn ich sie vom moralischen Thron aus tue und nicht weiss,
dass nur der Steine werfen darf, der ohne Sünde ist (Joh. 8, 7), wenn ich vergesse: „Wer sich lässet dünken, er stehe, mag wohl zusehen, dass er nicht falle"
(1. Kor. 10, 12.) ?
Macht uns das sehr demütig in unserem Dienst, so darf doch gerade deswegen christliche Diakonie damit dienen, was Kirche durch Glottes Gnade sein darf:
die Gemeinde derer, denen Gott in Jesus Christus mit seiner grossen Barmherzigkeit begegnet ist und die deshalb mit ihrei* Nachfolge seine Liebe bezeugen.
Das ist nicht nur der Ursprung unserer Arbeit. Dadurch wird auch ihr Wesen gekennzeichnet. Wir kommen nicht nur mit unserer Barmherzigkeit. Auch
hier ist Diakonie nicht ohne Leiturgia und Martyria. Lasst uns doch von den Aposteln lernen, die an der schönen Türe des Tempels dem Bettler und Lahmen s a li?
gen: „Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir: IM
NAMEN JESU steh auf und wandle!" (Apg. 3, 6).
Dass wir uns nicht falsch verstehen: Wer einem Verhungernden anstatt ihn
zu speisen oder zu tränken nur aus der Bibel vorlesen würde, w ä r e nicht nur ein
Narr, sondern ein Gotteslästeer. Wer einem Verwundeten nicht wie der barmherzige Samariter „Öl und Wein" in die Wunden giesst, sondern eine lange oder
kurze Predigt hält, ist der gleiche. Aber andererseits danke ich es noch heute den
Mennoniten Nordamerikas, dass ihre Hilfssendungen am Ende des Krieges klar
und deutlich die Aufschrift trugen: „In t h e j N a m e of Christ!" Ich danke es noch
heute der Diakonisse des Krankenhauses, in dem ich als Schüler lag, dass sie uns
nicht nur Krankenpflegerin war, sondern am Abend und am Morgen im Gebet
zeigte, wer denn nun eigentlich gesund macht. Diakonie ist nicht nur Mitleid oder
soziale Verantwortung, ohne dass wir dies abwerten wollten. Ganz im Gegenteil!
Diakonie muss aber noch mehr sein. Sie ist dann recht, wenn sie nach Bodelschwinghs Grabspruch handelt: „Weil uns Barmherzigkeit widerfahren ist, w e r den wir nicht müde." Sie ist dankbare Liebe, Antwort und Hinweis zugleich auf
die Liebe, die das Heil der Welt bedeutet. Dass doch unsere Arbeit immer davon
durchzogen sei! Die Welt — und Gott — wartet auf die Menschen, die in den
Riss durch die Völker und Gemeinschaften treten und ihn füllen mit der Liebe
Christi.
Damit darf ich nochmals das Verhältnis von kirchlicher zu öffentlicher F ü r sorge 'berühren. Die beiden werden ja oft in Gegensatz gesetzt, obwohl nichts
unsinniger ist als dies. Wo ein Staat Wohlfahrtsstaat sein will, sollten wir nicht
unbedingt zur Seite stehen. Erfüllt er damit nicht etwas, woran wir die staatliche
Gemeinschaft immer wieder als Christen erinnern müssen? Und das nicht nur,
damit er es recht tue, sondern, dass überhaupt die Verantwortung getragen w e r de, die man in der öffentlichen Gemeinschaft füreinander hat! Die Diakonie wird
deshalb nicht arbeitslos. Sie wird das nicht im reichsten und besten Wohlfahrtsstaat. Welche Aufgaben erwachsen da erst der christlichen Kirche und ihrer Diakonie! Auch der reichste Wohlfahrtsstaat kann seine Fürsorge nicht nur mit sozialen Gesetzen durchführen, sondern bedarf der Menschen, die diese Arbeit tun,
eine Arbeit, bei der m a n keine Reichtümer sammeln kann. Werden wir dabei nicht
gleich an ein Versagen erinnert? Denn der Menschen sind nicht allzu viele,
die um des Dienstes und nicht um des Verdienstes willen in die Krankenpflege gehen. Wer sagt weiter dem Staate, iwas wirklich echte Fürsorge ist,
wenn nicht die Kirche, nicht weil sie ein Klub besonders kluger Leute wäre, sondern weil sie doch den hat, der in seinem Worte und seiner Wahrheit die Quelle
alles rechten Lebens ist? Wieviele Irrwege sind hier schon Staaten und Völker
gegangen! Der ist noch nicht einmal der schlimmste, wenn etwa wie in Südafrika
Menschenleben deswegen verbluten müssen, weil bei einem Unfall die Ambulanz
gekommen war, die gemäss Gesetz f ü r die andere Hautfarbe bestimmt war, nur
nicht f ü r die der verunglückten Person.
Nein — Diakonie wird nie arbeitslos. Öffentliche und kirchliche Fürsorge
werden sich immer ergänzen können und es kann nur vorteilhaft sein, wenn
unter ihnen eine echte Konkurrenz entsteht. Gott bewahre uns davor, dass sowohl
die Staaten als auch die Kirche anfangen total zu werden!
IIS
Nein — wir werden wirklieh nicht arbeitslos werden. Die Welt ist ja voller
Probleme und Nöte und wir Menschen erst recht. Ist aber nicht gerade deswegen
die Kirche in dieser Welt? Gewiss — sie hat auch nicht die Lösungen in ihrer
Hand. Aber — und damit komme ich zum Letzten, was wir uns unter unserem
Thema als Christen zu sagen haben:
Kirche — ist die Gemeinde derer, denen Gott durch Jesus Christus die Zukunft und die Heimat geöffnet hat.
Das ist es, w a r u m wir nie eine Konkurrenz zu fürchten brauchen werden.
Das ist es aber, w a r u m und womit wir an die Krankenbetten, zu den Hoffnungslosen und Trauernden und zuletzt zu den Sterbenden, zu den Gefangenen und
Entrechteten, zu denen die nicht mehr können, und zu denen, die nach menschlichem Urteil nur halbe Menschen sind, treten können. Das ist es, warum unsere
Seelsorge nicht ein billiges Geschwätz oder Vertröstung auf eine ferne Zukunft
ist, sondern die Hinführung zu Jesus Christus, „der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Lieht gebracht hat."
Damit tun wir unseren Dienst und damit können wir ihn noch dort tun, wo
menschlich gesehen nichts mehr zu hoffen ist. Wie kann man das etwa bei einem
Bodelschwingh oder Löhe lernen! Nichts braucht unsere Welt nötiger als solche
Menschen, die in diese (Hoffnungslosigkeit die H o f f n u n g Jesus Christus bringen,
in diese Heimatlosigkeit die ewige Heimat, ja die diese Welt und ihre Menschen
mitnehmen auf den Weg zur Heimat mittels ihres Betens, Hörens und Arbeitens!
Denn das heisst doch eigentlich rechte Seel- und Leibsorge zu üben. Gott schenke
uns, dass wir nie vergessen, dass wir Menschen sein dürfen unter dem Bekenntnis, das der Weltkirchenkonferenz zu Evanston 1954 als Thema gedient hat: Jesus Christus die H o f f n u n g der Welt!
Ich darf schliessen mit dem Diakonissenspruch Neuendettelsaus, dem Worte
Wilhelms Löhe, eines der Grossen unserer Lutherischen Kirche f ü r den Dienst
det Diakonisse:
„WAS WILL ICH? DIENEN WILL ICH. WEM WILL ICH DIENEN? DEM
HERRN IN SEINEN ELENDEN UND ARMEN. UND WAS IST MEIN LOHN?
ICH DIENE WEDER UM LOHN NOCH UM DANK, SONDERN AUS DANK
UND LIEBE; MEIN LOHN IST, DASS ICH DIENEN DARF. UND WENN ICH
DABEI UMKOMME? KOMME ICH UM, SO KOMME ICH UM ,SPRACH ESTHER,
DIE DOCH I H N NICHT KANNTE, DEM ZULIEBE ICH UMKÄME, UND DER
MICH NICHT UMKOMMEN LÄSST. UND WENN ICH DABEI ALT WERDE?
SO WIRD MEIN HERZ GRÜNEN WIE EIN PALMBAUM, UND DER HERR
WIRD MICH SÄTTIGEN MIT GNADE UND ERBARMEN. ICH GEHE MIT
FRIEDEN UND SORGE NICHTS."
119
Dr. HELMUTH SCHÜNEMANN — Santiago
Wie half unsere Kirche deutschen Einwanderern, die
nach dem 2. Weltkrieg nach Chile kamen?
Die deutschen evangelischen Gemeinden in Chile haben seit ihrem Bestehen
(ungefähr 1860) sich ganz bewusst darauf beschränkt gehabt, ihre Glaubensüberzeugung unter sich lebendig zu erhalten und Werke der Liebe, die aus dieser
Überzeugung sich ergaben, f ü r sich und die Gemeindefamilien durchzuführen. Es
erwuchs aus dieser Haltung fast von selbst, dass die Träger der privaten deutschen Schuleinrichtungen — wie Schule, Kinderheime usw. —meist Glieder dieser
Gemeinden waren, die zwar unabhängig von der Kirchengemeinde, aber teilweise
bewusst als Beweis ihres christlichen Glaubens diese Erziehungsstätten förderten.
Auch die Einrichtung von privaten Friedhöfen, Diakonissenstationen, Kindergärten, Altersheimen, die hin und wieder ihre Arbeit begannen, aber auch wieder
verschwunden sind, ist fast ganz auf die Kirchengemeinden und ihre deutschsprechenden Mitglieder zurückzuführen, wenn auch die Gemeinde als solche nicht
Trägerin dieser Einrichtungen war.
Heute nach hundert Jahren dürfen wir nicht klagen über diese Entwicklung,
wenn sie auch nach der Sicht, die wir heute als Aufgabe einer Kirchengemeinde
verstehen, in anderer Weise fortgeführt werden muss. Denn durch sie sind zwei
Werke auf unsere Zeit gekommen, die sonst nirgends so bewusst durchgeführt
und vielen Menschen zum Segen wurden: 1.) die Gaben f ü r die notleidende Bevölkerung im deutschen Mutterland und 2.) die A u f n a h m e deutscher Flüchtlings 1 familien in Chile. Die Treue, die ganz gewiss auch ein Zeichen christlichen Glaubens ist und die die christlichen Gemeindeglieder in Chile besonders auszeichnet,
hat sich dieser beiden grossen Aufgaben in einer Weise angenommen, die man
nur dankbar anerkennen kann, Wir wollen bei aller kritischen Sicht, die heute
teilweise an unseren Gemeinden geübt wird, nie vergessen, dass diese beiden
Werke niemals in dem Ausmass hätten geleistet werden können, wenn nicht diese1
exklusive Treue auf das deutsche Erbe bestanden hätte.
Über das Hilfswerk f ü r die Not in Deutschland hat Propst Karle selbst einen
Bericht in dem Buch von Pastor Martin Hennig „Sie gingen übers Meer" geschrieben. Exakte Zahlen lassen sich schwer ermitteln, aber die Angaben, dass etwa
40.000 deutschstämmige Menschen aus Chile in drei Jahren eine halbe Million
Dollar aufbrachten und dadurch mehr als eine halbe Million Tonnen an Lebensmitteln und Kleidungsstücken von hier nach drüben gingen, ist ein beredtes Zeugnis von der Tätigkeit dieses Werkes.
120
Verbunden mit dieser Treue, mit der die Gemeinden ihre ursprünglichen Aufgaben erfüllten, ist die Verantwortung f ü r die Einrichtungen, die nötig waren.
Im Gegensatz zur alten Heimat, in der auch organisatorisch die Fürsten oder die
Regierungen die Landeskirchen verwalteten, mussten die evangelischen Gemeinden hier und anderwärts im Ausland sich selber helfen und die Mittel f ü r die
Erhaltung aufbringen. Dies bedeutete eine oft harte und sehr genaue Arbeit, die'
aber dazu beitrug, dass die Gemeindeglieder anders mit den Aufgaben einer Kir-'
chengemeinde verwuchsen, als es dort möglich ist, wo die Gemeinde-Leitung von
der Landesregierung abhängig ist.
Nun die Frage: was konnte unter diesen Umständen von den Gemeinden aus
geschehen, um dem Flüchtlingsstrom besonders deutscher evangelischer Familien
aus dem Osten Europas nach dem zweiten Weltkrieg Einhalt zu gebieten und
wirkliche Aufnahme zu gewähren? Schon einmal hatten sich während des ersten:
Weltkrieges evangelische Gemeindeglieder zusammengetan, um die an der Küste
Chiles abgesetzten deutschen Seeleute unterzubringen. Diese jungen Menschen,
die zunächst auf ein rasches Kriegsende gewartet hatten oder teilweise auch unter
abenteuerlichen Umständen die Heimat zu erreichen suchten, wurden von ihren
Reedereien nach zwei Jahren Nichtstun und erzwungener Ruhe entlassen;
sie
versuchten nun, sich eine Lebensstellung zu erwerben. Da haben viele auf den
Landbesitzen der Deutsch-Chilenen oder in kleinen Handwerksbetrieben eine vorläufige Bleibe gefunden, die sie später weiter ausbauen konnten. Gerade diese
Männer, von denen allerdings höchstens 30% sesshaft wurden, Familien gründeten
und so wertvolle Mitglieder der Gemeinden blieben, haben viel Verständnis f ü r
die Flüchtlingsnot nach dem 2. Weltkrieg gezeigt. Doch genügte diese private
Initiative f ü r die Not, die nach dem Kriege durch Briefe, Berichte und Menschen
unter uns bekannt wurde? Musste nicht noch Grösseres vorbereitet werden?
Sehr viel Überlegungen, noch einmal brauchbares Land zum Kolonisieren
zu bekommen, wurden angestellt. Viele Söhne der dritten und vierten Generation,
im Süden Chiles hätten gern den Versuch unternommen, sich ebenfalls auf Regierungsland, wie die Ahnen vor hundert Jahren, einzurichten. Ausser den Ländereien in der Frontera (den alten Araukanergebieten) ist es nur gelegentlich zu
kleinen geschlossenen Siedlungen gekommen. Meist sind diese Versuche fehlgeschlagen, weil die staatlichen Ländereien nicht mehr direkt an die Familien gegeben wurden, sondern das Ansiedeln durch private Siedlungsgesellschaften betrieben wurde, die nicht mit der nötigen Rücksicht auf das Wohl der Familien,
sondern oft nur aus Geschäftsinteressen arbeiteten. (Man kann das teilweise
schon im Siedlungsgebiet von Lonco Toro oder bei Muermos oder am Rupancosee
beobachten). Dass noch heute ein Familienvater durch Ankauf von privaten
Ländereien seinen Kindern eigenes Land zum Leben gibt, kommt nur noch selten
vor. Allerdings gibt es Ausnahmen, sodass bei festem Willen der Eltern und grossen Anstrengungen der Kinder gelegentlich drei bis vier Kinder (ich weiss einen
Fall von acht Geschwistern) zu eigenem Grund und Boden zum Aufbau kommen.
Seit etwa 20 Jahren sind die Blicke aus solchen Gründen auf die chilenischen
Provinzen südlich von Puerto Montt gerichtet, die nur noch auf dem Meereswege
oder neuerdings durch die L u f t von der Zentralzone zu erreichen sind. Schon die
Insel Chiloe. aber auch das Hinterland von Chaiten auf dem Festland bietet viel121
leicht manchen tüchtigen Familien Gelegenheit,
mit Aufzucht von Grossvieh,
Melkereien oder Sägewerken zu arbeiten. Aber diese Ländereien sind heute fast
ausnahmslos in Händen von Firmen oder Privatleuten, die sie zur Ausbeute des
teilweise noch wertvollen Urwaldsbestandes besitzen oder gepachtet haben. Wieder anders liegen die Verhältnisse in der Provinz Aysen, in der an der Küste und
im Inland Ländereien vorhanden sind, die direkt vom Staat vergeben werden und
teilweise aufgeteilt sind. Hier im Palenatal und am Lago Rosalet im Innern haben
sich tatsächlich seit etwa 1950 einige deutschstämmige Familien aus dem Süden
Chiles Land geben lassen, das sie durch Bearbeitung und Bebauung nach Abzahlungen in Eigentum verwandeln können. Aber diese Ländereien sind noch heute
so schwierig zu erreichen, die Verbindung per Wasser so zeitraubend und unregelmässig, dass es schon aus diesem Grunde sehr schwierig ist, dort Nicht-Chilenen anzusiedeln. Andererseits haben wir in dem nördlichen Teil der Provinz Aysen den Beweis einer kleinen aber aktiven Kolonistengruppe aus dem Sudetendeutschtum, die 1934 ins Land kamen und sich an der Küste eines der vielen Kanäle oder Fjorde im Süden ansiedelten (Puyuhuapi hinter der Magdaleneninsel):
Diese wenigen Menschen, die ein Vortrupp f ü r nachkommende Verwandte waren
(nach dem 2. Weltkrieg aus ihrer Heimat vertrieben), haben dank ihrer technischen Kenntnisse, ihres Fleisses und ihres Umstellungsvermögens trotz des regenreichen Klimas eine sehr achtbare Stellung erworben und werden von den chilenischen Behörden äusserst geschätzt. Welch Leid und Schwierigkeiten bei Schulproblemen, Arztmangel, ja oft einfacher Versorgung mit dem Notwendigsten
eintreten, vermögen nur Menschen zu beurteilen, die einmal längere Zeit dort im
Süden waren. Die grosse Hochebene der Provinz Aysen mit ihren Ortschaften
Coyhaique und Balmaceda, die schon patagonisches Kontinentalklima hat, bietet
wohl in abgelegenen Tälern manche Möglichkeiten der Siedlung, aber im Ganzen
sind die besseren Ländereien hier schon vergeben.
So blieb trotz aller Landreserven im Süden Chiles uns nur die Wahl, Flüchtlingsfamilien ins Ungewisse zu schicken oder ihnen mitten unter den Gemeinden
und ihren Gliedern ein Heimatrecht mit allem zu schaffen, was dazu nötig ist.,
Beides schien schwierig, ja fast unmöglich, und ich werde nicht vergessen, wie;
mir ein Gemeindeglied in berechtigtem Unmut aber .auch Sorge sagte: „alle die
Familien, die versagen, [werden dann bei Ihnen im P f a r r h a u s landen." Im L a u f e
der Zeit, als die Familien schon kamen und man sich innerhalb der Gemeinden'
mehr Rechenschaft über die Verantwortung gab, stellten sich zwei gleichwertige
Möglichkeiten der Unterbringung heraus, die dann auch nach Kräften ausgebaut
wurden: erstens Unterbringung und Arbeitsbeschaffung auf Kosten der Gemeinde, zweitens Aufnahme bei Privatleuten, hauptsächlich Landgutbesitzern, um die
Familien in landwirtschaftlichen Betrieben zu beschäftigen. Soweit ich es weiss,
sind an fuenf verschiedenen Orten mit mehr oder minder grosser Willigkeit Ver-r
suche gemacht, Familien auf Kosten der Gemeinschaft unterzubringen:
diese'
Orte gehörten zu den Siedlungen am See Llanquihue, die in den hundert Jahren
ihrer Entwicklung ein fast gleichmässiges Vorwärtskommen der einzelnen Familien gehabt haben. Durch ihren Kinderreichtum und die Abgeschlossenheit von
grossen Zentren der Wirtschaft haben diese Familien am Llanquihuesee
eine
grössere Bereitschaft der Selbsthilfe bewahrt als anderswo. So konnte in Llan122
quihue ein eigenes Haus am Friedhof errichtet werden, das eine Familie aufnahm,
die gleichzeitig eine Aufsicht über diesen schönen Gartenfriedhof am See ausüben sollte. In Totoral wurde das alte, nicht mehr zweckgebundene Schulhaus
als Wohnung f ü r eine Vertriebenenfamilie eingerichtet, in Frutillar nahm die
Schulgemeinde ausser einer Lehrerfamilie, die als Vertriebene kam, noch eine
weitere Familie in ihren Räumen auf, schliesslich hat sich das Gemeindefrauenwerk in Purranque um Unterbringung und Arbeitsbeschaffung f ü r eine Familie
gekümmert. Aber auch Freiplätze an Schulen und Internaten, Kleidungsstücke
u. a. wurden immer wieder von der Gemeinschaft erbeten und in vielen Orten
als Fortsetzung der ersten grossen Sammlung f ü r Deutschland den Familien
ausgeliefert. Es hat sich hier und — soweit mir bekannt ist — in Santiago, Osorno und Puerto Montt doch im kleinen Masse gezeigt, dass die hundertjährige Arbeit der Kirchenvorstände, Pfarrer usw. in unseren Gemeinden nicht vergeblich
war.
Einen anderen Charakter bekam die Aufnahme, wenn der Besitzer eines landwirtschaftlichen Betriebes — vielleicht sehr abgesondert von Nachbarn deutscher
Sprache — sich einer oder zwei Flüchtlingsfamilien annahm. Aus 2 Gründen w a r
dies ein Wagnis, das f ü r Menschen, die Chile nicht kennen, fast unverständlich i
scheint: 1) Der chilenische Landbesitzer deutscher Abstammung arbeitet seit Generationen fast ausschliesslich mit Arbeiterfamilien auf seinem Besitz, die nach
Wohnweise, Ausbildung und allgemeiner Lebensauffassung (kulturell) nicht europäisch ausgerichtet, sondern den europäischen Menschen gegenüber mit einem
Minimum an Kulturgütern zufrieden sind, weil sie im Grunde nichts anderes kennen und wünschen. Man kann das weder dem "Patron" noch dem „Arbeiter" zum
Vorwurf machen, weil beide vom Leben tatsächlich etwas Verschiedenes erwarten. Nun sollen Familien aufgenommen werden, die die gleiche Lebensweise wie
die Besitzer haben, aber sozial in die Stufe der Arbeiter eingereiht werden. Vom
rein wirtschaftlichen Standpunkt konnte ein Besitzer bei Aufnahme der Flüchtlingsfamilien nur von der Überlegung ausgehen: Mit 'einer europäischen Familie
gewinne ich Arbeitskräfte, die den teils recht grossen Maschinenpark fachmännisch in Ordnung halten oder durch Pünktlichkeit und Pflichtbewusstsein die teils
nicht zuverlässigen, aber gutmeinenden einheimischen Kräfte übertreffen. 2) Die
Arbeitsweise auf einem Landgut im Süden Chile's ist in vieler Hinsicht von der
Bearbeitung eines Besitzes in Europa oder anderswo so sehr verschieden, die Behandlung der einheimischen Arbeiterfamilien so eigenartig (denken wir allein
an die Sprache, die in landwirtschaftlichen Fachausdrücken beherrscht sein will),;
dass mit einem gewissen Recht gesagt wurde: es ist ausgeschlossen, dass sich
eine Familie aus Europa rasch einlebt, so rasch, dass wir einen Nutzen davon
haben.
Im Blick auf diese Tatsachen können wir mit Recht sagen, dass wirklich n u r
die christliche Haltung eines Menschen es fertig brachte, alle Bedenken zur Aufnahme einer oder mehrerer Flüchtlingsfamilien zu überwinden. Wer nicht aus
Gründen der Verantwortung gegenüber Gott und seinem Willen in Jesus Christus überzeugt wurde, eine Flüchtlingsfamilie .aufzunehmen, ihr Arbeit und Brot
zu geben, den konnte man nicht mit andern Gründen überzeugen. Die Pflicht, diese seelsorgerliche Arbeit an den Gemeindefamilien zu üben, hatten die P f a r r e r
123
unserer Kirche, und es war keine leichte Aufgabe ,die ihnen damit gestellt w a r .
Denn der P f a r r e r k a n n t e j a selbst nur seine Gemeinde, nicht die Flüchtlingsfamilie. Die w u r d e n ihm durch die verschiedenen Weltorganisationen, besonders
durch den Lutherischen Weltbund zugeschickt. Jeder, der in den grossen Verbän- 1
den nach dem Kriege mitgearbeitet hat, von den Riesennöten etwas weiss, die
den Menschen auf der Flucht begegnen, der bekennt, wie es f a s t unmöglich ist,
alles in die „richtige" Bahn zu lenken. Die genauesten Berichte über das, was eine
Familie an Arbeitseinsatz, Verdienstmöglichkeit usw. hier in Chile
erwartete,
konnten in den grossen L a g e r n der wartenden, u n r u h i g e n Menschen k a u m v e r arbeitet, geschweige denn a u f g e n o m m e n werden. W a r es ü b e r h a u p t möglich, einen Satz wie etwa diesen zu verstehen:
hier in Chile gibt es n u r sehr wenig
Möglichkeiten des raschen Vorwärtskommens und Verdienstes, wir können höchstens ein „Auskommen" bieten? Und dieser Satz kam aus einem Lande, das in
„Ruhe" beide Weltkriege überstanden hatte und das gemessen an nutzbarem Boden eine geringe Bevölkerungszahl h a t ! Dass man abgesehen von wenigen „bereiten" christlichen Helfern hier mit Menschen zu tun hatte, die die Einwanderer
teils als Eindringlinge, teils als Menschen mit f r e m d e r L e b e n s a u f f a s s u n g betrachtete., wollte diesen gehetzten Menschen nicht in den Sinn. Man f r a g t e überhaupt
nicht viel, sondern griff n u r die erste Möglichkeit auf, in Verhältnisse zu k o m men, die f e r n a b von dem grausigen Geschehen lagen — und da w a r Chile allerdings das e n t f e r n t e s t e Land, das A u f n a h m e bot.
Und nun kamen sie — die ersten im Juli 1950 — tropfenweise, meist 2 oder
3 Familien zusammen, betreut auf den verschiedenen Wartestationen ihrer Reise
durch christliche Hilfsstellen (Auswanderermission in H a m b u r g oder Bremen,
Einwandererheim des Luth. Weltbundes in Buenos Aires, gelegentlich mitreisende P f a r r e r auf den Schiffen) und sie reisten durch die argentinische P a m p a bis
an die Cordillera.
Dann — eine bleibende E r i n n e r u n g f ü r alle, die den W e g über Bariloche in
das alte Siedlungszentrum im Süden Chile's n a h m e n — das Einfallstor über die
Seen und Berge, zu Schiff und L a s t w a g e n nach P u e r t o Varas oder Qsorno! Wenige k a m e n als Einzelgänger, die meisten in Familien mit Kindern ganz verschiedenen Alters. Wer in der Geschichte deutscher A u s w a n d e r u n g e n Bescheid weiss,
der konnte sich beim Anblick dieser Gruppen ein kleines Bild f r ü h e r e r Zeiten m a chen. Sie kamen ebenso wie f r ü h e r nicht a u s einer bestimmten Ecke Deutschlands aus dörflichem Zusammenhang, sondern z u s a m m e n g e w ü r f e l t aus den verschiedenen Gauen oder jetzt aus den verschiedenen Volksdeutschen Gebieten im
Osten Europa's: Siebenbürgen, Banat, Galizien, Polen und Ukraine; auch Balten
und Memelländer w a r e n unter ihnen. Alle hatten nun aber auch schon eine lange
Zeit (meist 5—6 J a h r e ) Lagerleben oder Ansässigkeit im Deutschland der Nachkriegszeit hinter sich, sodass die Erinnerungen an die alte Heimat teilweise durch
neue Eindrücke — besonders bei der Jugend — verwischt war. Sie alle aber kamen — ähnlich wie vor 100 J a h r e n — mit der f e s t e n Absicht, sich hier in Chile
eine Heimat auf Erden zu schaffen, nach Möglichkeit zu Eigentum zu kommen.
Aber gerade diese H o f f n u n g w u r d e am allerschwersten betrogen; nur ein
Beispiel: Eine Familie, die als Kundschafterin f ü r viele ukrainische Familien deutscher H e r k u n f t h i e r h e r k a m und Siedlungsland suchte, konnte es schwer verwin124
den, dass diese Aussichten völlig bei Seite gelegt werden mussten. Dabei stand
das Haupt dieser Familie im Lehrerberuf, aber er meinte, dank der Tüchtigkeit!
und Energie, die er bei seinen Landsleuten kannte, Siedlungsmöglichkeiten er-;
zwingen zu können. Welch ein Schmerz war es, diesen Menschen die Unmöglichkeit
dieses Weges klar zu machen. Heute — 10 J a h r e später — k a n n unsere Kirche
nur mit Dank feststellen, dass sie sich nicht auf eine Siedlung in irgendeinem
Teil Chile's einliess. Wir haben hier das traurige Beispiel von dem Siedlungsversuch bei La Serena gehabt, wo bei allerbestem Willen und Bereitschaft verschiedener Stellen der deutschen Gemeinschaft ein Siedlungsunternehmen nach dem 2.
Weltkrieg zusammenbrach. Ich glaube nicht falsch zu urteilen, wenn ich sage,
dass die Menschen aus Europa, gerade auch die Volksdeutschen aus den östlichen Ländern, nur in engem dörflichen Zusammenhang Siedlungsmenschen sind,
während das Ertragen der Einsamkeit, wie es das Einzelsiedeln hier in Chile e r fordert, den Menschen unseres technischen Zeitalters einfach unmöglich ist. Selbst
bei grossen Mitteln, die aber nicht vorhanden waren, wäre ein solcher Versuch
— etwa in der Provinz Aysen — gescheitert
Die andere fast ebenso schwere Enttäuschung, die die Familien durchleiden
mussten, war die Ausbildung der jungen Menschen. Schon die 7—8jährige Schulausbildung f ü r die Kinder machte Schwierigkeiten, da die meisten Flüchtlingsfar
milien auf den Landgütern fernab von jedem deutschen Schulzentrum sassen. Da
musste Internatsunterkunft gesucht und bezahlt werden! Aber nun die Weiterbildung, die doch Aussicht auf eine Lebensstellung bieten sollte! N u r die wenigsten jungen Menschen hatten den Anfang oder die Vollendung einer „Lehre" hinter sich. Sie waren trotz aller Unzulänglichkeiten nach dem Kriege durch die
staatlichen Stellen der werdenden Bundesrepublik unterstützt worden,
hatten
Fortbildungskurse oder Fachschulen .besuchen können. Diese Art Schulen gibt
es hier im Lande nur f ü r die Kinder, die eine gewisse Ausbildung in chilenischen
Volksschulen hinter sich haben, vor allem die Landessprache gut beherrschen.
Solche Schulen gibt es nur in wenigen grösseren. Städten des Landes. So blieb
als Lehre nur der „Betrieb", die „Garage" oder das Bleiben auf dem Lande zur
Bedienung und Aufsicht einfacher Maschinen. Für die Mädels war es etwas leichter, da zuverlässige Kräfte im Haushalt und f ü r Kinderpflege gesucht wurden,
besonders aber die deutschen Kliniken im ganzen Lande sich nach gutem weiblichen Pflegepersonal umsahen. Aber auf's ganze gesehen war es ausserordentlich
schwierig, dieser Jugend und ihren Eltern Vertrauen in die Zukunft einzuflössen.
Irgend welche grösseren Geldmittel standen nicht zur Verfügung, um Darlehen
zur Ausbildung zu gewähren.
Was diente nun unter diesen Umständen zur Ausbildung? Einige junge Leute
versuchten es als Lehrlinge in Garagen, Tischlereien, Anstreichunternehmen usw.
Aber die Unzulänglichkeit einer solchen Ausbildung kann nur einer beurteilen,
der selbst den Süden Chile's kennt. Der Hauptberuf, der bei grosser körperlichen
Anstrengung und treuer Ausführung am meisten Erfolg bot, war der Transport
landwirtschaftlicher Produkte. Es ist heute nicht zu bestreiten, dass ohne die jungen deutschen Männer aus Osteuropa die Milchzentren wie Nestle, CALO (beide
in Osorno) oder Lechera del Sur (Frutillar, Neu Braunau und anderwärts) die
Transportfrage nicht gelöst hätten. Tage- und nächtelang haben sich die jungen
125
Männer (teilweise mit ihren Vätern) abgequält, ihre Pflichten den Gesellschaften
gegenüber zu erfüllen, die Lastwagen, die sie auf Abzahlung zur Verfügung bekamen, zu pflegen oder gegebenenfalls wieder umzutauschen. Es war ein hartes
Brot, was da erarbeitet und gegessen wurde, besonders im Blick auf die „satten"
Menschen in der Nachbarschaft, die auf dem Erbe der Väter ausruhten.
Wer mit den Flüchtlings-Familien öfters zusammenkam oder sie heute kennt,
weiss, dass in ihnen die Frage oft aufgeworfen wird: W a r u m sind wir nicht mit
unsern Verwandten nach Canada oder U. S. A. oder gar Australien ausgewandert? Dort haben es die Familien viel leichter, rasch vorwärts zu kommen, die'
meisten haben sich schon Eigentum erwerben können. Es ist nicht ganz leicht,
auf diese Fragen eine rechte Antwort zu geben. N u r wollen wir nicht vergessen,
dass ihnen bereitwilligst sowohl von staatlichen Stellen, wie von den deutschen
Gemeinschaften besonders den christlichen Gemeindegliedern Aufnahme hier
in Chile bereitet wurde. Sie werden nun nach den ersten J a h r e n bitterer E n t t ä u schung merken, dass sie wertvolle Mitarbeiter in einem Lande bleiben können,
das unseren kulturellen Bestrebungen auf deutscher Linie mit Achtung und Wohlwollen entgegenkommt.
Denn was zunächst unmöglich schien, hat sich dank aller Zusammenarbeit
der Beteiligten als gangbar erwiesen: etwa 500 Personen konnten dem Flüchtlingsschicksal entrissen und festgewurzelt werden. Nicht eine Organisation (unsere lutherische Kirche ist viel weniger- eine Organisation wie etwa die ¡katholische) hat das zustande gebracht, sondern viele Männer und Frauen, die sich „unorganisiert" dafür einsetzten — nur aus Glauben! Dass die Flüchtlinge in allen
Enttäuschungen auch heute noch unter uns leben, ihre Arbeit haben, teilweise ihr
Lebensglück durch Heirat mit jungen Ibero- oder Deutsch-Chilenen gefunden
haben, ist ein Wunder Gottes, wenn wir auf die Anfänge dieser Flucht sehen! Wir
alle wollen dafür dankbar sein!
126
Inhalt
Seite
Adoli Wischmann:
EINLEITUNG
AUF NEUEN UND ALTEN WEGEN
Wilhelm Stadtländer:
PROPST FRIEDRICH KARLE
UND DIE DEUTSCHE SCHULE
Martin Haug:
DAS GEHEIMNIS DER BERGPREDIGT
Theodor Heckel:
PANJS PRO VITA MUNDI
Bruno Leuschner:
ANGST UND HOFFNUNG
Siegwart Berendes:
RELIGION OHNE ENTSCHEIDUNG
Werner Honold:
DAS ERDBEBEN IN CHILE 1960
Helmut Beisiegel:
DIE KONFIRMATION
Claus von Plate:
. MEIN GELIEBTES SANTIAGO
Di. Juan Westermeyer: KANN UND DARF DER CHILENISCHE AKADEMIKER SEINEN DEUTSCHEN KERN HÜTEN UND
BEWAHREN?
Roberi Dick:
WARUM GEWERBESCHULE IM SÜDEN CHILES?
Stewart W. Herman:
BODEN UND SAAT
Rudolf Obermüller:
VIELERLEI KIRCHEN — E I N HERR
Friedrich Hübner:
VON SCHICKSAL UND SENDUNG DES AUSWANDERERS
Emi! Böning:
DIE FLÜCHTLINGE AUS DER ZEIT NACH DEM
ZWEITEN WELTKRIEGE ALS SEELSORGSPROBLEM
Roland Henke:
BEGEGNUNG MIT DER MUTTERKIRCHE
Juan Hepp Dubiau:
SOZIALE FÜRSORGE, E I N E ETHISCHE PFLICHT
DER CHRISTLICHEN GEMEINDEN IN CHILE
Hans-Joachim Lakus:
EVANGELISCHE SOZIALAHBEIT IN CHILE
Hans Holledertr:
GRUND UND WISSEN CHRISTLICHER DIAKONIE
Helnryuth Schünemann: WIE HALF UNSERE KIRCHE DEUTSCHEN EINWANDERERN, DIE NACH DEM 2. WELTKRIEG
NACH CHILE KAMEN?
5
6
g
10
14
20
32
43
49
57
63
70
73
78
82
86
88
97
101
109
120